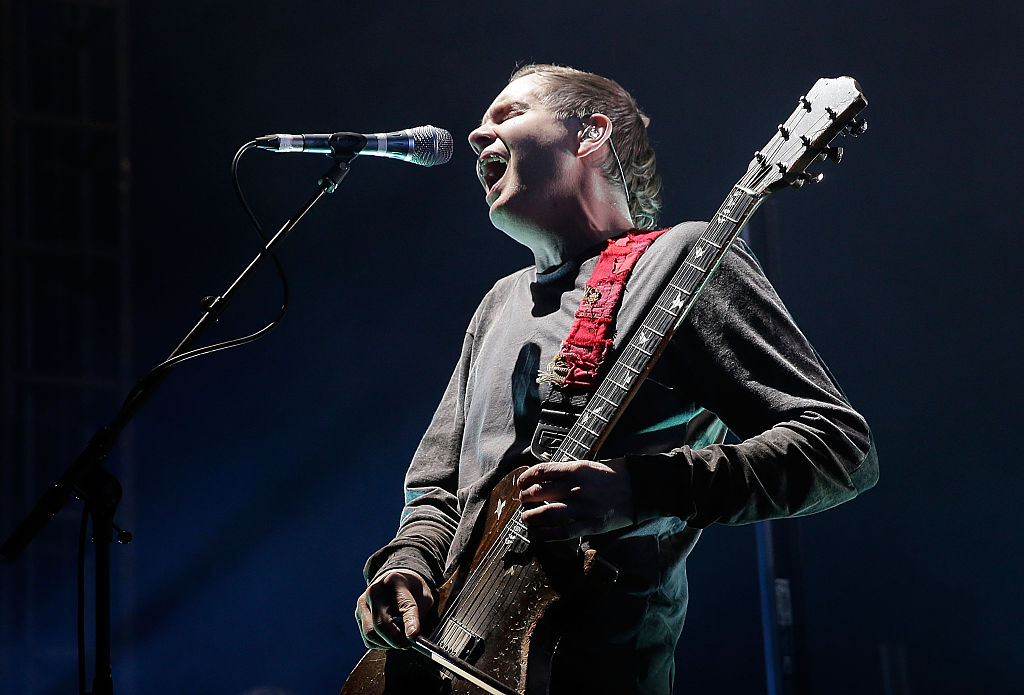Exitus
Vor zehn Jahren erlebte der Reggae einen weltweiten Höhenflug. Bob Marley war in aller Munde, und mit Namen wie Jimmy Cliff, Peter Tosh, Third World oder Black Uhuru schien nichts und niemand den Reggae aufhalten zu können. Doch dann ging es rapide bergab: Heute produziert die jamaikanische Plattenindustrie in erster Linie Cover-Versionen und platte Schmuse-Schnulzen — Kreativität scheint nicht mehr gefragt. Nach dem „Exodus“ nun der Exitus. Der Reggae ist tot, Martin Shaw sprach mit der Leiche.
Die Nummer „Sleng Teng“ gibt’s auf vier LP’s, ungefähr 20 Singles und diversen Maxis“, erzählt Keith Stone vom Reggae-Plattenladen Daddy Kool mitten in London. „Insgesamt gibt’s von „Sleng Teng“ wahrscheinlich mehr als 132 verschiedene Versionen. Noch gefragter ist im Moment „What The Hell“, ursprünglich von Echo Minoti; davon stehen jetzt mindestens sechs Versionen in den Läden, und es werden immer mehr. Wir haben schon überlegt, ob wir nicht eine eigene Nummer rausbringen und sie „What the Fuck“ nennen sollen.“
Nach 11 Jahren als einer der erfolgreichsten Händler mit Reggae bleibt Keith Stone bei der derzeitigen Geschäftslage nur noch sein Galgenhumor. Was er besonders vermißt, sind Originalität und echte Begeisterung.
Die aktuellen Reggae-Platten lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
auf der einen Seite die altbewährten Rhythmen früherer Reggae-Hits; sie dienen den DJs als Grundlage für ihr „Toasting“ einen Rap-ähnlichen Sprechgesang mit eher oberflächlichen Dancehall-Themen.
Auf der anderen Seite die schlüpfrige Anmache von Platten wie Sophia Georges „Girlie, Girlie“; abgeschwächte, persilsaubere Versionen davon finden sogar ihren Weg in die englischen Charts. Die sozial und politisch engagierten Texte, die den Reggae einst auszeichneten, sind längst in Vergessenheit geraten.
Die Geschichte beginnt in den 20er und 30er Jahren: In Jamaica vereinigen sich amerikanischer Rhythm & Blues, kubanische Trommeln, europäische Akkordstrukturen und brasilianischer Samba zu einem Kalypso-ähnlichen Gemisch namens Mento. Da sich soziale und politische Veränderungen in einem Land mit nur zweieinhalb Millionen Einwohnern wesentlich schneller durchsetzen als in einer festgefahrenen Industriegesellschaft, erlebte Jamaikas Industrie einen enormen Aufschwung, als das Land 1%1 in die Unabhängigkeit entlassen wurde. Die jamaikanischen Musiker wollten mitreden und die Mißstände in den Ghettos an den Pranger stellen.
In den folgenden Jahren verlangsamte sich der Mento zum Ska-Rhythmus, der die Skalites. Jamaikas große 60er Band, bekannt machte. Dann, etwa 1970, erreichte die Opposition gegenüber Buster Mantes konservativer Regierung seinen Höhepunkt. Politische Versprechungen waren nicht eingehalten worden, und in einer Zeit wachsender Unzufriedenheit machten Rastafarians, rüde boys und andere sufferersihrem Ärger mit einer Musik Luft, die die Stimmung im Volk widerspiegelte. Es entstand ein langsamer, quälender Rhythmus — der Rocksteady —. der dann schließlich die Schlagzeug- und Baßfiguren entwickelte, die man Reggae nennen sollte.
Der Optimismus kehrte zurück, als Michael Manleys sozialistische PNP-Partei an die Regierung kam. Die fünf Jahre zwischen 1975 und „80 waren erstaunlich fruchtbar, eine Periode musikalischer Kreativität, die in der Karibik ihresgleichen sucht.
In derselben Periode trat auch Rastafari, vorher eine Minderheiten-Sekte, soweit in den Vordergrund, daß sie ein Teil von Jamaikas gängigem Image wurde. Die Protest-Songs wurden über Radio, Fernsehen und die DJs mit ihren Sound Systems unters Volk gebracht, wobei ganz neue Stars entstanden: die Discjockeys selbst.
Der Reggae-Botschafter aber war Bob Marley. Bezeichnender Weise hatte Marlev seinen internationalen
DER REGGAE-DUDEN
RASTAFARI: Anhänger einer Religion, benannt nach dem äthiopischen Kaiser Haile Selassi I. (geboren 1892 als Ras Tafari Makonnen, gestorben 1975). Die Rastafari (kurz: Rastas) propagieren die Rückkehr („Exodus“) aller Schwarzen nach Afrika, von wo sie im Zuge des Sklavenhandels verschleppt wurden. Echte Rastas essen vegetarisch, rauchen Gras und kämmen sich nie die Haare: Die Negerkrause verfilzt zu Dreadlocks. DREAD: Schlüsselwort der Rastas. Die ursprüngliche Bedeutung („fürchterlich“, „gefürchtet“) wurde ins Gegenteil verkehrt (ähnlich wie „bad“ bei den amerikanischen Schwarzen). Dread beschreibt u.a. das furchtlose Auftreten der Rastas, schwierige Situationen oder wird als Grußwort verwandt. RÜDE BOYS: Jugendbanden, ähnlich den Straßengangs amerikanischer Großstädte. SUFFERERS: „Leidende“ sämtliche Opfer sozialer, wirtschaftlicher und politischer Mißstände (Arbeits-, Obdachlose etc.). Ein eingefleischter Rastafari wird schnell zum sufferer, da er alle Gesellschaftssysteme „Babylons“ strikt ablehnt. BABYLON: Die nicht-afrikanische, besonders die westliche Welt. Babylon ist sündig und wird von den Rastas bis zur Rückkehr nach Afrika nur als vorübergehendes Exil betrachtet. SOUND SYSTEM: Kompakte, früher tragbare Discothek (zwei Plattenspieler, Mikrofon, Verstärker und Boxen), die im Laufe der Zeit immer größer wurde (vor allem die Boxen). TOASTING: Rhythmischer Sprechgesang der Discjockeys, vergleichbar dem amerikanischen Rappen. ROOTS: Die Wurzeln, die Traditionen und Kultur des schwarzen Mannes.
Erfolg nicht mit den umstrittenen frühen Hvmnen wie „Slavedriver“
(Jedesmal wenn ich den Peitschenknall höre, gefriert mein Blut“) sondern mit den späteren, gemäßtigteren Stücken „Exodus“, „Waiting In Vain“ oder „Jammin'“.
BOB MARLEY
Tatsächlich war Marley wahrscheinlich der einzige Reggae-Musiker, der die Maschinerie der Pop/ Rock-Industrie sicher beherrschte. Durch seinen Amerika-Aufenthalt und seine langjährige Beziehung zum Chef von Island Records, Chris Blackwell, lernte er die vielen Tricks der Branche kennen. Promotion und Verpackung sind, so wußte er bald, ebenso wichtig wie die Platte selbst. Ohne die Werbe-Unterstützung von Island und Songs für den Massen-Geschmack hätte Marley den Sprung vom König des kleinen jamaikanischen Reggae-Markts zum internationalen Superstar nie geschafft.
Während Marley als Schaumkrone einer Welle verwässerten Reggaes die Welt eroberte, tauchten zu Hause die ersten Anzeichen des baldigen Ablebens der jamaikanischen Musik auf. Michael Manleys Amtszeit hatte wenig dazu beigetragen, die großen Erwartungen seiner Landsleute zu erfüllen, und im Vorfeld der Regierungswahlen kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Manley und der Oppositionspartei. Edward Seagas konservativer JLP. 1978 artete das politische Geplänkel zwischen den rivalisierenden Anhängern zum Bürgerkrieg aus.
Manley, der als ehemaliger Musikstudent den mobilisierenden Einfluß von Musik kannte, lud Marley zum geschichtsträchtigen „One Love Peace Concert“ ein. mit dem Hintergedanken, daß dieser Auftritt, verbunden mit einem öffentlichen Aufruf von Jamaikas liebstem Sohn, dem Blutbad vielleicht ein Ende setzen könnte. Daß Marley (wenn auch nicht offiziell, so doch ideell) Manley unterstützte, war bekannt — so bekannt, daß eine Woche vor dem Konzert ein Attentat auf ihn verübt wurde. Die Täter entkamen unerkannt, waren aber höchstwahrscheinlich Dunkelmänner hinter Seaga.
Obwohl angeschossen, trat Marley trotzdem auf, und das Konzert endete mit einem aufgesetzt friedlichen Händeschütteln der Rivalen Manley und Seaga. Im Verlauf der politischen Auseinandersetzungen waren mehr als 900 Menschen getötet worden. Seaga gewann die Wahlen 1980. (Fragt man seine Gegner, so lautete sein Slogan: „Tote reden nicht.“)
Die jamaikanische Wirtschaft unter Seaga zwang die einheimische Plattenindustrie zu rationalisiertem Protitdenken, es wurden nur mehr sichere Hits gebucht. Seaga ging sogar soweit, allzu deutliche Protest-Songs einfach zu verbieten, weil sie zu aufwieglerisch seien: was ihm um so besser gelang, da er nicht gegen eine Masse Musiker angehen mußte, sondern lediglich gegen die paar Produzenten, die in Jamaika das Sagen haben.
Dem jamaikanischen Produzenten gehört nämlich das Studio, also bestimmt er auch, wer wieviel Zeit darin verbringen darf. Er kauft dem Künstler dessen Material für eine relativ niedrige Pauschale ab. kommt für die Kosten einer Platte ganz allein auf und hat dafür das exklusive Vertriebsrecht. Wird das Ding ein Hit, erhält der Künstler oft genug keine Gewinnbeteiligung. Zählt man Zensur, Monopolstellung der Produzenten und deren Profitorientierung zusammen, wird der Verfall des Reggae offensichtlich.
Daher das momentane Dilemma: Mit dem kommerziellen Erfolg im Kopf gehen die jamaikanischen Produzenten auf Nummer sicher, und ihre Musiker müssen ihnen in einen jetzt schon kleinen und immer kleiner werdenden Markt folgen.
Ein weiteres Problem sind die Aktivitäten der angelsächsischen Plattenfirmen, die Nicht-Raggae-Acts promoten. Sie haben Jamaika als Markt entdeckt, auf dem sie ihre Produkte absetzen können, um so ihre anderswo sinkenden Umsätze wenigstens halbwegs wettzumachen. Boy George und Wham! etwa hört man im jamaikanischen Radio ebenso häufig wie Einheimisches.
Die Reggae-Helden von eestern trifft allerdings genausuviel Schuld an der momentanen Misere. Bunny Wailer ist ein gutes Beispiel für einen Sänger, der seine Chance einfach nicht wahrnahm, als sie sich bot. Während sich Bob Marley dem Streß von Promotion und Tourneen aussetzte, um ein größeres Publikum zu erreichen, blieb Bunny Wailer — mit Peter Tosh einer der Original-Wailers — lieber zu Hause. Er machte ein paar Platten für Island und hat jetzt sein eigenes Label, ist aber aufgrund der Unfähigkeit oder Weigerung, seine Musik angemessen zu vermarkten, inzwischen in Vergessenheit geraten.
Ebenso Augustus Pablo: Der kam erst jetzt zum erstenmal auf Tour nach Europa — etliche Jahre, nachdem seine innovative Arbeit weltweit Beachtung zu finden begann. Die Geschäftstüchtigeren, wie Sly Dunbur und Robbie Shakespeare, haben den Trend schon früher erkannt und das sinkende Schiff längst verlassen: sie widmen dem Reggae jetzt nur noch einen Bruchteil ihrer Zeit. Mit Studioarbeit für internationale Größen wie Grace Jones. Mick Jagger. Bob Dylan. Yoko Ono und andere können Sly & Robbie nun mal wesentlich mehr Geld verdienen.
DAS ENDE
11. Mai 1981: Bob Marley hegt tot in einem Krankenhaus in Miami; der Krebs hat einer außergewöhnlichen Karriere ein jähes Ende gesetzt. Dieses Ereignis läutet das Ende des Reggae auf dem Weltmarkt und einen Rückgang nach Jahren stetigen Wachstums ein. Die Plattenindustrie kümmert sich nicht mehr um Musik für Minderheiten, weil sie in der globalen Wirtschaftsflaute nur noch ihren Profit im Kopf hat. Wenn das Geld regiert, kann sich alternative Musik dahin schleichen, wo sie hergekommen ist. Reggae-Protest-Texte haben in einer Welt von Supergruppen und ewigen Comebacks von Supergruppen keinen Platz.
Die britische Band Steel Pulse kann ein Lied davon singen, was passiert, wenn die Bosse ihre Prioritäten neu setzen. Nachdem sie in den 7()ern Seite an Seite mit weißen Punk-Bands beachtlichen Erfolg hatte, gehört sie inzwischen in die Kategorie „verschollen“. Nach langen Jahren in England leben Steel Pulse jetzt in Los Angeles; Leadsänger David Hines macht dafür unter anderem den Geschmacks-Wandel beim englischen Publikum verantwortlich:“.Reggae wurde Anfang der 80er durch das Ska-Revival und die Two Tone-Gruppen (Madness, Specials etc.) verwässert, und dann kam die neue Reggae-Pop-Welle mit Gruppen wie Musical Youth. Sicher, sie waren erfolgreich, aber wenn sie Hardcore-Reggae gespielt hätten, hätten sie nicht einen Hit gehabt. „
Dem englischen Reggae räumt David allerdings mehr Zukunftschancen ein als seinem jamaikanischen Pendant. „In Amerika und überall auf der Welt kommt der englische Reggae besser an als der jamaikanische, weil wir wesentlich mehr gemeinsame Erfahrungen mit der Industriegesellschaft, ihren Ghettos und ihrer städtischen Denkweise haben als die Jamaikaner auf ihren 230 Ouadratkilometern.“
Steel Pulse sehen ihre Zukunft trotz allem optimistisch, da Weltprobleme wie Drogen, Apartheid und Atomenergie auch die Europäer betreffen und ihr Bewußtsein sensibilisieren. Irgendwann, glaubt David, wird das europäische Publikum wieder für Hardcore-Reggae empfänglich sein, und auf diesen Augenblick wartet die Band.
GHETTO-MUSIK
Von einer solchen Entwicklung scheint man in den Schaltzentralen von Plattenindustrie. Radio und Fernsehen allerdings noch nichts gehört zu haben. Trotz der einstigen Popularität des Reggae wurden die Sendezeiten gekürzt und auf unattraktive Tageszeiten verlegt. Ohne ständiges Airplay sehen die DJs aber keine Chart-Chancen für einen Reggae-Song. Und mit Problem-Texten ist sowieso nichts mehr zu holen, weil — so ein britischer Discjockey — die heutige Jugend zwar mit Arbeitslosigkeit und allen Härten des Lehens konfrontiert sei, diesen Realitäten aber nicht mehr wie in den 70ern ins Auge schaue, sondern sie lieber vergesse, um e.s sich statt dessen so gut wie möglich gehen zu lassen.
Schlechte Zeiten für Hardcore Reggae-Anhänger und -Macher: Wer nicht eingehen will, muß Kompromisse schließen. Wie Chris Cracknell, A&R Manager (Talentscout, Entdecker) für die englische Firma Greenslccves Records. Selbst er, der seine Plattenfirma vor 11 Jahren gründete, um nur ernsthaften Reggae zu verkaufen, gibt zu: „Obwohl wir mit hohen Idealen angefangen haben, mußten wir in einem so kleinen Markt Kompromisse schließen und verkaufen jetzt, was gerade angesagt ist. „
Für den Berufszweig der „rappenden“ DJs, deren Aufgabe/Lebensunterhalt es war, mit ihren sound Systems die Botschaft des schwarzen Mannes und seiner roots zu propagieren, gibt es in dieser Hinsicht keine Kompromisse. Sie sind weitgehend von der Bildfläche verschwunden und hoffen, daß Rassenbewußtsein im Reggae eines Tages wieder gefragt sein wird.
Eine eher trügerische Hoffnung, angesichts der Tatsache, daß seit Bob Marleys Tod kein Plattenlabel eine Reggae Band unter Vertrag genommen und in großem Umfang promoted hat. Mal ganz abgesehen davon, daß die besonderen Werbe-Aktivitäten, die für Bob Marley unternommen wurden, sowieso nur einer verschwindend kleinen Minderheit von Popstars zuteil werden.
Im Juni ’86 hat CBS die neue schwarze Hoffnung Bloodfirc Posse unter Vertrag genommen. Die fünf jungen Jamaikaner erregten mit ihren mitreißenden Auftritten bei den Sunsplash-Konzerten in Jamaika. Amerika und England weltweit Aufmerksamkeit, ein Album ist gerade erschienen, und sie sind Vorgruppe auf ÜB 4üs gegenwärtiger England-Tour.
Dabei sind Bloodfirc Posse eine stark durch die 80er geprägte Band. Mit dread haben sie überhaupt nichts am Hut; ihr geschleckt sauberes Image hat schon mehr von dem, womit man heute Platten verkauft. Ihr Reaggae ist eine computerisierte, klinisch reine Angelegenheit, die Verlangen nach mehr Rückgrat statt der ganzen Politur weckt. Sie sind eher ein Äquivalent zu den zuckersüßen Five Stars als zu einem jungen, aggressiven Bob Marley.
Diese Kritik haben sie allerdings schon oft zu hören bekommen…Reggae-Künstler sind die Vorreiter einer neuen Generation jamaikanischer Reggae-Künstler“, erklärt Bassist Benji. „Die Texte haben sich zu lange an dasselbe Protestschema gehalten. In unseren Texten machen wir zwar auch sozialkritische Anspielungen, aber wir propagieren nicht Rasta. weil das nicht unsere Religion ist. Das Schlimme an den lOern war, daß die Texte immer die gleichen waren, ohne eine Lösung anzubieten. Wir haben eine Message an die Leute, aber sie ist subtiler — und es liegt am Publikum, sich damit auseinanderzusetzen oder nicht.“
Sie schreien nicht mehr, sie flüstern. Eine traurire Situation, aber im Spiel um die Marktanteile bleibt den Reggae-Musikern gar nichts anderes übrig. Und Bloodfire Posse haben nicht die Absicht zu verlieren.
„Wir versuchen, einen individuellen Sound zu entwickeln“, erläutert Gitarnst Danny Brownie. „so wie das Bob Marley mit den Wailers gemacht hat. Dieser Sound soll verschiedene Gefühle ausdrücken, unter anderem Liebe. Wir protestieren nicht um des Protests willen. Wir wollen über allen neuen Musikstilen stehen und das, was uns gefallt, übernehmen. Wir wollen auch die beste Technik, die man kriegen kann, weil Reggae-Musiker früher selten den Qualitätsstandard hatten, der für Europäer oder Amerikaner selbstverständlich war. „
WAS BLEIBT?
Die messagebewußten Dickschädel des Reggae — wie Half Pint. Ini Kamoze oder Freddie McGregor — gibt’s zwar auch noch, aber sie sind in der Minderheit. Yellowman, Albino-DJ und Erfinder schlüpfriger Macho-Sprüche, will offenbar seine Erfolge von 1983 wiederholen: genau das Richtige für alle, die auf billige Musik und sexistische Texte stehen. Und Rob Partridge, Pressesprecher von Island Records in England, erzählt, daß sich Island jetzt wieder mehr auf Reggae konzentrieren werde. Außer Sly & Robby und Ini Kamoze haben sie Altstars wie Augustus Pablo und Junior Delgado unter Vertrag genommen. Auf den ersten Blick sieht es also nach einer Rückkehr der guten alten Zeit aus, als Reggae noch „Wahrheit und Freiheit“ bedeutete.
Währenddessen. Samstag nacht, auf irgendeiner schweißtriefenden Tanzfläche in London: Die Youngster hüpfen zur x-ten Version von „What The Hell“. Gleich gibt’s einen Schieber, und dann wird der DJ entweder von seinen sexuellen Heldentaten oder von seiner Schlagfertigkeit beim toasting erzählen. Was auch immer, es hat nur für den Moment Bedeutung. Und wenn am Morgen die Putzkolonne kommt, wird an der Wand stehen: Reggae ist tot! Lang lebe das, was davon übrig ist!