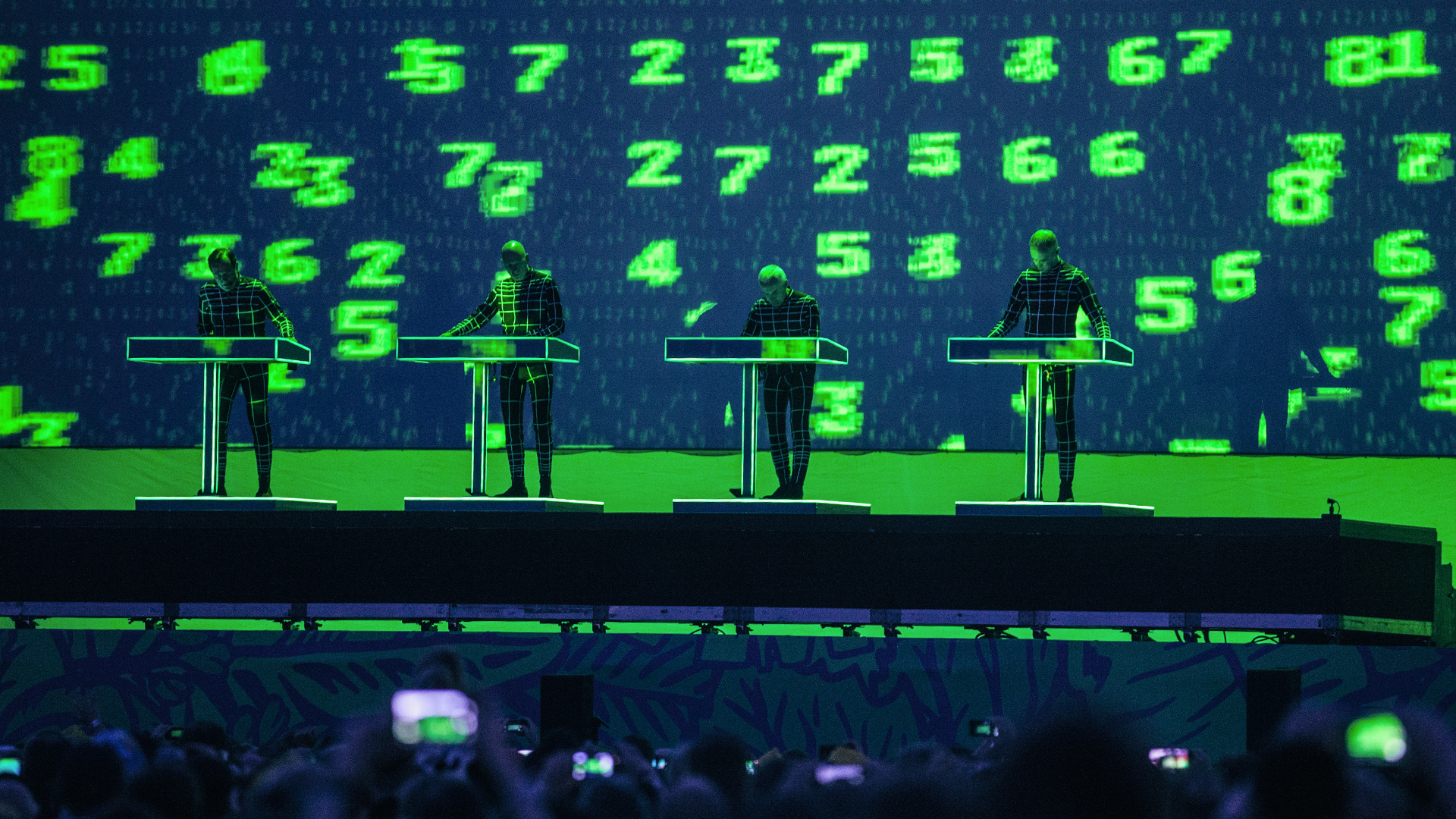Unser Prince-Special: Teil 2
Auf der Musikexpress-Facebook-Seite fragten wir unsere Fans nach der größten Pop-Ikone. Prince bekam die meisten Stimmen knapp vor Dave Grohl und Madonna. Die Begeisterung für Prince teilten auch etliche ME-Rezensenten: Fünf Prince-Alben erhielten bei uns die Maximalbewertung von sechs Sternen – Rekord! Wir portraitieren den Künstler mit einer Bildergalerie und zwei der zahlreichen Artikel aus unserem Bereich DAS ARCHIV - REWIND.

„Ihr“, das sind Mitarbeiter von Universal Records und ein paar wenige Journalisten. Ob Prince selbst der Geschichte, die er bereits geschrieben hat, noch das eine oder andere gewichtige Kapitel hinzufügen können wird, ist ungewiß. Sein neues Album ist stellenweise inspiriert – der Opener ist ein harter, progressiver Funk, der den besten Tracks auf dem Black Album in nichts nachsteht, und die Single „Black Sweat“ eine Art „Kiss“ für 2006 -, über weite Strecken aber auch erschreckend langweilig. Der Online-Teaser „Te Arno Corazon“ plätschert ereignislos dahin wie „Money Don’t Matter 2 Night“, mehrere Disco-Tracks könnten Reste aus BATMAN-Sessions sein, und ein ausgedehnter Funk-Jam ist so dröge, daß kaum jemand der Anwesenden widerstehen kann, das Blackberry aus der Tasche zu ziehen, um kurz nach neuen E-Mails zu sehen.
So vertieft in Gespräche oder drahtlose Communicator sind am Ende der Platte die meisten Gäste, daß kaum jemand bemerkt hat, daß der Mann endlich erschienen ist, auf den alle so gespannt gewartet haben. Er steht in einer unbeleuchteten Ecke des Raumes und hat sich eine Gitarre umgehängt. „Wir spielen jetzt einen Showcase für meine Lieblingssängerin Tamar“, sagt er in ein Mikrofon, und es gibt zögerlichen Applaus. Prince und ein paar andere Musiker – darunter Sheila E. an einem kleinen Percussion-Set – stellen sich ganz in den Dienst der schwarzen Funk- und Soul-Sängerin. Tamar singt ein paar eigene Stücke und viele Klassiker und versucht alles, um die Gäste aus der Reserve zu locken. Sie hat es nicht leicht, denn die Augen des Publikums ruhen auf Prince. Da sich dieser aber mit Ausnahme von ein paar seltenen „Oh my god!“- oder „Clap your hands!“-Ausrufen ganz darauf konzentriert, als Rhythmusgitarrist unsichtbar zu sein, will keine Stimmung aufkommen. Nach und nach werden die Hits billiger – neben „Play That Funky Music“ wird auch Michael Jacksons „Don’t Stop ‚Til You Get Enough“ bemüht -, und einige Gäste nach und nach betrunkener. Auch eine kurze Version von „Partyman“, die von den wenigsten als Prince-Komposition erkannt wird, kann nichts mehr daran ändern, daß schließlich eine Atmosphäre wie auf der Weihnachtsfeier eines Großkonzerns herrscht. Obwohl sowohl der Auftritt als auch das Album ihre unterhaltsamen Momente haben, macht sich bei einigen Gästen doch Enttäuschung breit. Mißt man den Mann an seinen Großtaten der Vergangenheit, dann bleibt er seit Jahren schon weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Zwei Faktoren dürften diese Regression in einen Zustand des kreativen Vorsich-hin-Dämmerns begünstigt haben: Zum einen hat Prince die Lust an der Selbstdarstellung, die einst treibende Kraft seines künstlerischen Ausdrucks war, weitgehend verloren – auch bei größeren Shows und Award-Galas wirkten seine Auftritte zuletzt oft wie die Erledigungen einer Pflicht, eher obligatorisch als wirklich funkenschlagend. Seine Melange aus Funk, Jazz, Pop, Sex und Selbstherrlichkeit allerdings funktioniert ohne den unbedingten Willen, im Rampenlicht zu stehen, nur bedingt. Zum anderen steht er seit einigen Jahren einer religiösen Sekte nahe, deren Ideologie seinen einst so freien Geist, der Grundlage einer außergewöhnlichen kreativen Unbeschwertheit war, auf maßgebliche Weise beschränken dürfte. Daß bei den Zeugen Jehovas – wie jeder unter www.watchtower.org nachlesen kann „vorehelicher Geschlechtsverkehr, Ehebruch […] und Homosexualität“ als „schwere Sünden gegen Gott“ gelten und zudem ausdrücklich vor Musik gewarnt wird, „die von falschen religiösen Inhalten inspiriert ist oder sich auf moralische Entgleisungen und Dämonentum konzentriert“, dürfte einen Angehörigen dieser Gemeinde in kreativen Belangen durchaus befangen machen.
Obwohl „U Can Come If U Want To But U Can Never Leave“ auf der Einladung stand, werden um vier Uhr die letzten Gäste hinauskomplimentiert. Läßt man den Abend Revue passieren, während man zwischen den üppig bewässerten Gärten der Hollywood Hills auf den Wagen wartet, wird eines klar: Für Prince geht ein Lebensabschnitt zu Ende. In den letzten 20 Jahren hat er uns im Studio, bei bombastischen Shows und oft mehrstündigen Aftershow-Gigs so viel gegeben, wie kaum ein Entertainer seiner Generation. Heute fällt es ihm schwer, sich mit dieser Figur noch zu identifizieren, seine Fans aber halten krampfhaft an ihr fest. Ein solches Ungleichgewicht wird es ihm nicht leicht machen, zu einem neuen künstlerischen Selbstverständnis zu finden. Wenn Prince nicht mehr Prince sein will – haben wir dann das Recht, von ihm enttäuscht zu sein? Vielleicht ist es ist an der Zeit, ihn gehen zu lassen…
Zurück zum ersten Teil des Artikels
Aus unserer Oktober-Ausgabe 1984 – „Der geile Prince“: