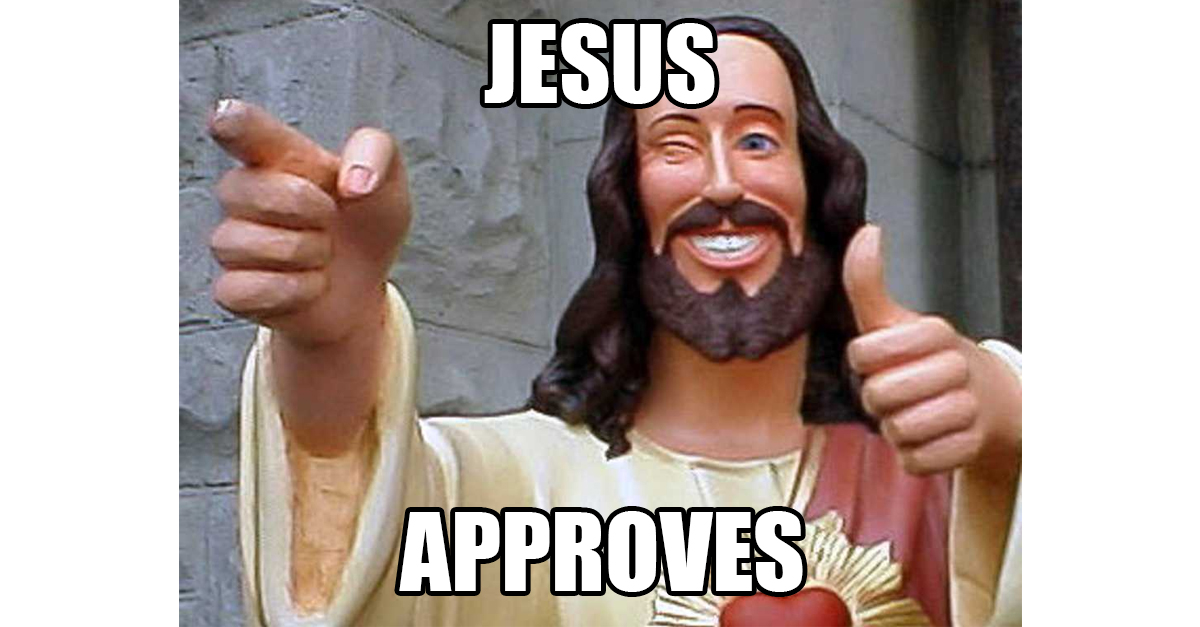Tom Waits
„ICH HABE EIN IMAGE, DAS SICH LANGST KULTIVIERT HAT, weit weg von dem, wie ich wirklich bin. Was ich jetzt versuche, ist Kurs zu halten zwischen Pomp und Gosse“, hat Tom Waits einmal gesagt. Das „einmal“ war 1977, Ende der 80er war er das letzte mal mit Band in Europa, und nun also: drei ausverkaufte Konzerte im Metropol-Theater. Dort ertönt als erstes „Earth Died Screaming“, ein Song vom 92er Album „Bone Machine“ – und Waits ist von der ersten Sekunde an er selbst und sein Image. Er bellt, er krächzt, er schreit. Das angeschossene Tier, waidwund, aber seit Jahrzehnten immer weiter auf der Flucht. Mit dem sehr realen zerknautschten Hütchen auf dem verstruwwelten Kopf, dem viel zu engen Jackett, der schlabbernden Jeans. Die ganze Kleidung nicht wirklich schmutzig, aber gekonnt bekleckert. Der Staub, den Waits eigens auf seinen Bühnenplatz hat karren lassen, tut sein übriges. Ach was, er macht sich prima in der präsizesparsamen Lichtshow, sehr archaisch, sehr normal, Staub ist eben immer und überall. Vor allem, wenn Waits ihn bearbeitet. Er stampft, er marschiert auf der Stelle, schwitzt und schneidet sich alle möglichen Grimassen ins zerknitterte Gesicht. Tom Waits singt „Jesus Gonna Be Here“, und wenn hier einer Heiland ist, dann Waits selbst – der einzige dieser Art auf dieser Welt. Zwischendurch sind immer wieder billige Belohnungen fällig, das Ganze ist schließlich ein großer Zirkus der Alltäglichkeiten, und Waits ist der Direktor. Konfetti hat er reichlich in den Taschen, und er läßt es gerne regnen. Auf Gitarrist Smokey Hormel, auf Standbassist Larry Taylor und natürlich auch auf sich selbst. Bei Bedarf macht Waits ordentlich Radau und erzählt zwischen den Songs schöne Schnurren. Über die Substitution des sonntäglichen Kirchgangs zum Beispiel: Wer dort säumig war, solle doch „testamints“ essen – kleine Süßigkeiten, die beidseitig bedruckt sind: auf der einen als Insignie des Christentums ein Kreuz, auf der anderen ein frommer Bibelspruch. „But I guess there are many people in the audience who didn’t go to church today and didn’t eat testamints…“ Klar, daß die Rettung trotzdem nicht weit ist: Waits singt den „Chocolate Jesus“. Als alle gesalbt sind, gibt er später mit ebenso einfachen wie effektvollen Mitteln den manisch-wachsamen Nachbarn, der die Geräusche von nebenan deuten will: Im Saal ist’s zappendüster als Waits, die Taschenlampe kinnwärts unter den Fusselbart geklemmt, „What’s He Building“ zelebriert. Eine großartige Performance. Um auch ja in der Abteilung der slow songs nicht allzusehr in kollektiver Emotionalität zu baden, gibt Waits, mittlerweile am Klavier, für „Innocent When You Dream“ eine Bedienungsanleitung: „You can sing with me, but I tell you when you can join me.“ Die volle Ladung Gefühl war’s dann natürlich trotzdem, und die hält auch vor, als mit „Pony“ das Loblied auf den kleinen Gaul kommt: „I hope my pony knows the way back home“ – ein Song übrigens, den Waits als Tierfreund anstimmt. Wie er überhaupt findet, daß man mehr Lieder über Tiere machen müsse. Und über Lebensmittel. Und über Menschen sowieso. Kathleen, seine Frau, ist auch so ein Mensch. Der widmet Waits dann die letzte Zugabe, „Picture In A Frame“. Tom Waits in Berlin, das war keine schnöde Best-of-Show. „Downtown Train“, „In The Neighbourhood“, „Tom Traubert’s Blues“- allesamt wunderbare Songs, die man gern gehört hätte. Und doch war’s schön stimmig, weil dafür andere, kleine Songs drankamen. Es war das Konzert eines Künstlers, der sich ebenso wahrhaftig wie perfekt selbst inszeniert, auf der Bühne krumm macht, gekonnt spastisch die menschliche Vogelscheuche gibt und dabei so wohltemperiert schmuddelig daherkommt, daß man voller Bewunderung feststellen muß: Was die Sache mit dem Image angeht, hält Tom Waits die Balance wie kein Zweiter. Schön, dabeigewesen zu sein.