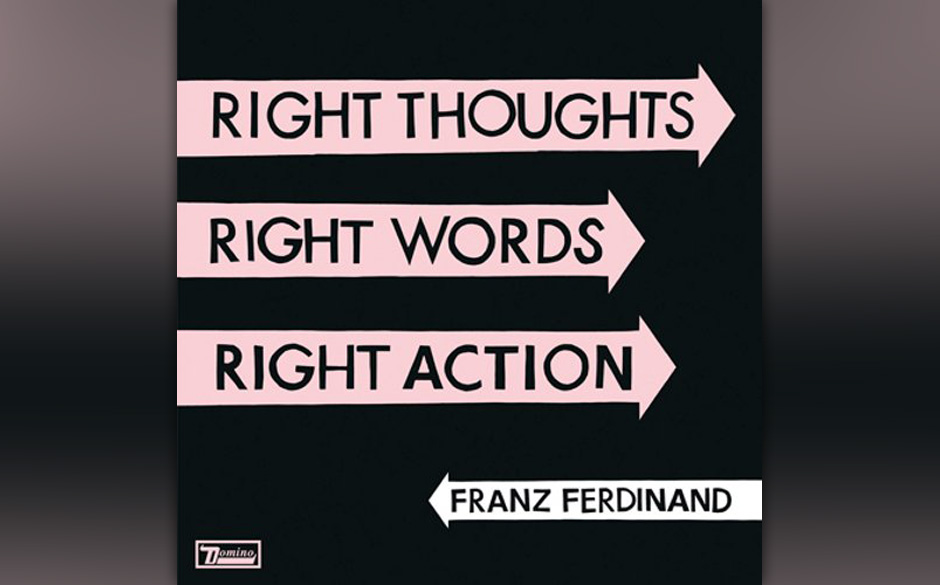Zola Jesus
Taiga
Mute/GoodToGo
Die Ex-Goth-Prinzessin greift nach dem Pop – ihr beim Scheitern zuzuhören ist eine zähe Angelegenheit.
TAIGA ist ein widersprüchliches Album. Nika Danilova aka Zola Jesus schrieb die Songs auf einer abgeschotteten Insel im US-Staat Washington. In der Isolation entstand eine Platte, die die Massen bewegen soll. Deswegen wechselte Zola Jesus vom Boutique-Label Sacred Bones zum Indie-Veteranen Mute, deswegen arbeitete sie zum ersten Mal mit einem Produzenten, deswegen ließ sie dem Pop-Gespür, das sie früher unterdrückt hatte, freien Lauf. Das Ergebnis dieser Veränderungen ist ihr bislang zugänglichstes Album.
Dean Hurleys Produktion ist klinisch sauber und Danilovas Stimme frei von den gothicartig anmutenden Lo-Fi-Verfremdungen ihres Debütalbums, THE SPOILS (2009). Danilova klingt mittlerweile weniger wie Siouxsie Sioux und mehr wie die hypererfolgreichen Nebelhörner Sia (im starken „Dangerous Days“) und Rihanna („Hunger“). Schade, denn ihr histrionisches Röhren passte perfekt zu den industriellen, kratzbürstigen Beats ihrer frühen Platten. In Interviews erzählt Danilova jetzt gern, dass Architektur ein wichtiger Einfluss beim Komponieren gewesen und dass TAIGA ein Kommentar zur „Rolle des Menschen in der Natur“ sei.
Ähnlich zäh, wie sich solche Statements lesen, hört TAIGA sich leider auch oft an. Die Musik schwankt zwischen Kanye-West-Egomanie (Zola Yeezus?) und orthodoxem, maschinellem Chart-Pop. Ab und an gibt es Überraschungsmomente: das Aphex-Twin-eske Intro zu „Ego“, den Drum’n’- Bass-Ausbruch im Titeltrack –, aber mit dem großen Pop-Wurf wird Zola Jesus bis zum nächsten Album warten müssen.