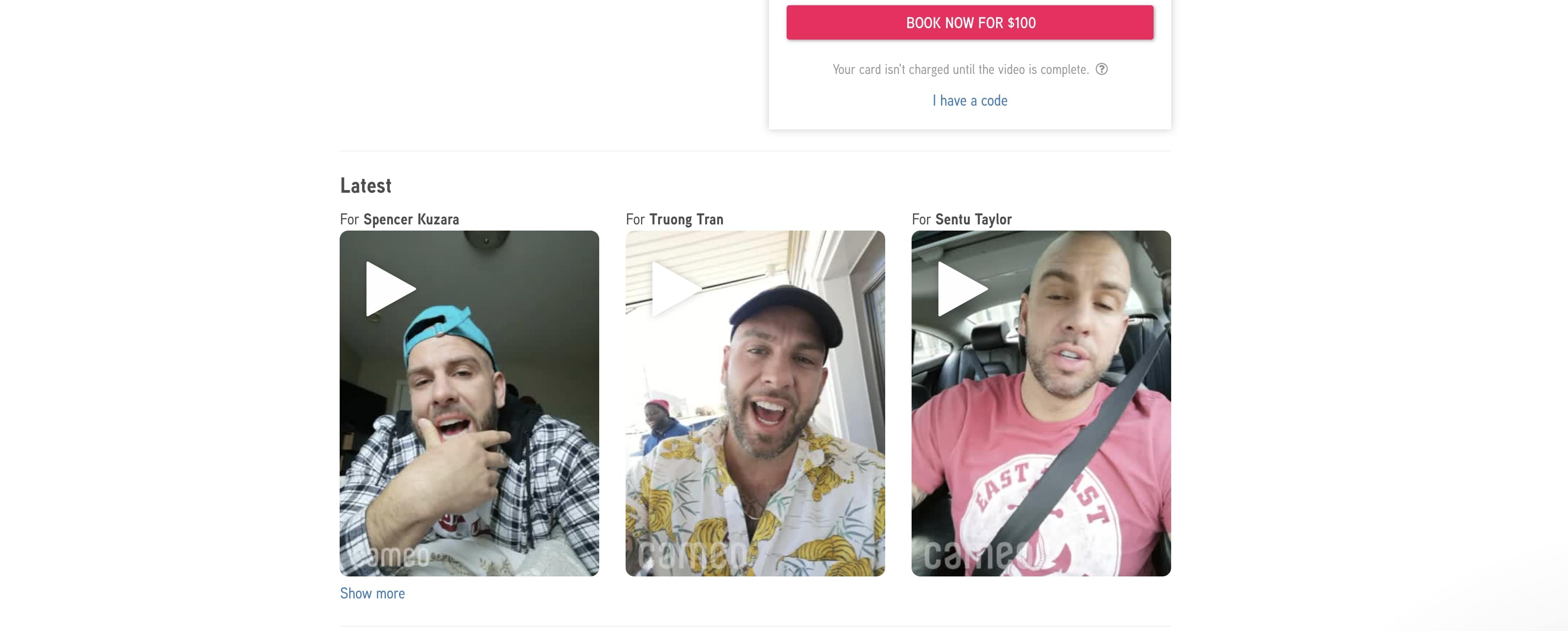Ariel Pink
Pom Pom
4AD/Beggars/Indigo
Neues aus dem Geisterhaus des Pop: Psychedelic Beat, Grunge, Vaudeville – der Pop-Prinz aus L. A. navigiert auf seinem bislang exzentrischsten Album zwischen den Stilen.
Man liest ja jetzt alle paar Tage etwas von Ariel Pink. Kürzlich erzählte er in einem Interview, dass Madonna mit dem Wunsch an ihn herangetreten sei, ihr doch ein paar Songs mit Kanten zu schreiben. Die Diva, so seine Einschätzung, befände sich seit ihrem ersten Album auch auf dem absteigenden Ast. Daraufhin muss Madonnas Manager Guy Oseary kurz, aber heftig geschnaubt haben: „Wir haben noch nie von Ariel Pink gehört. M ist nicht interessiert an der Arbeit mit Meerjungfrauen.“
Gleich, wie viel Wahrheit in diesen Kolportagen steckt, die kleine Gemeinheit erzählt von dem Selbstverständnis, das der 1978 in Los Angeles geborene Ariel Marcus Rosenberg auf seinen beiden Erfolgsalben BEFORE TODAY (2010) und MATURE THEMES (2012) so vortrefflich hat ausstellen können. Die Stimmen aus dem Geisterhaus des Pop wollen endlich an die Oberfläche geführt werden, und Ariel Pink ist der Renaissancemeister, der der Melodie im Zeitalter von Beats und Bits wieder zu ihrem angestammten Recht verhilft. Die Seele seiner Musik war schon immer in den melodieseligen Sixties geparkt, seit er seinen LoFi-Keller gegen einen Sound-Park eingetauscht hat, in dem Prince Regie führen könnte, schillern seine verschrobenen Songs aber in den Farben echter Pop-Hits. Der Mann mit dem Mondgesicht, das zuletzt von einer Kirmesdarstellerfrisur eingefasst wurde, deren Tönung nun auch dem Namen des Musikers zur Ehre gereicht, leistet sich inzwischen auch die Launen eines Superstars.
Pink ist mit POM POM ein Doppelalbum (17 Songs, 69 Minuten) aus den Zauberfingern gerutscht, das es in puncto Eklektizismus und Exzentrik mit den groß angelegten Werken des Funk-Meisters aus Minneapolis aufnehmen kann. Wir hören im Eröffnungstrack „Plastic Raincoats In The Pig Parade“ gar eine Reminiszenz an die psychedelischen Tagträume des Prinzen aus Paisley-Park-Tagen. Diesmal schlägt Pink vokale Purzelbäume über wild ins Kraut schießenden Chören und davonjagenden Gitarrenriffs, er amüsiert sich süß säuselnd über „Sexual Athletics“ (die Beats hat er dem „Ballroom Blitz“ von The Sweet abgeguckt) und lässt einen Frosch auf einem auch schon wieder seltsam lustigen und anspielungsreichen Track quaken („Exile On Frog Street“). Vielleicht auch nur eine Grußadresse an die sich selber parodierenden Rolling-Stones-Kröten. Aber jedem seine Lesart bitte, scheint Ariel Pink uns zwischen den Zeilen zuflüstern zu wollen.
Für „Dinosaur Carebears“ switcht er von der Gitarren-Herrlichkeit des Grunge zur elektronischen Vaudeville-Melodie und lässt sich final ins Reggae-Chill-out fallen. Der Megahit des Albums heißt „Nude Beach A-G-Go“ und klingt wie von einer Doo-Wop-Combo der 50s gespielt, die in einer Raumkapsel Richtung Mars rast und die Schönheit der Erde besingt.
Über 20 Musiker bietet Pink für das ungestüme und unverstellt nostalgische Showpopspektakel auf, Programmierer fürs Elektronische, Flötisten, Vibrafonisten, Gitarristen und Bassisten. Den 75-jährigen Kim Fowley hat er für die „Plastic Raincoats“ und das Jingle „Jell-O“ als Texter hinzugezogen. Momente einer Danksagung an den letzten Freak des Undergroundpop, der im Krankenhaus mit dem Krebs kämpft. Ariel Pink hat wie Fowley das absurde Theater aus dem Pop herausgekitzelt und es nun einer Art Zappa-Remix unterzogen. Eine gewisse Scheußlichkeit schillert dabei hin und wieder auf. Das passiert dann, wenn aus dem Witz Wahrheit wird, oder umgekehrt. Wahrscheinlich ist diese ganze Platte ein Witz, aber in diesem Moment, in dem der Pop einen Anker im Schaumbad der Stile und Einflüsse sucht, ein ziemlich guter Witz.