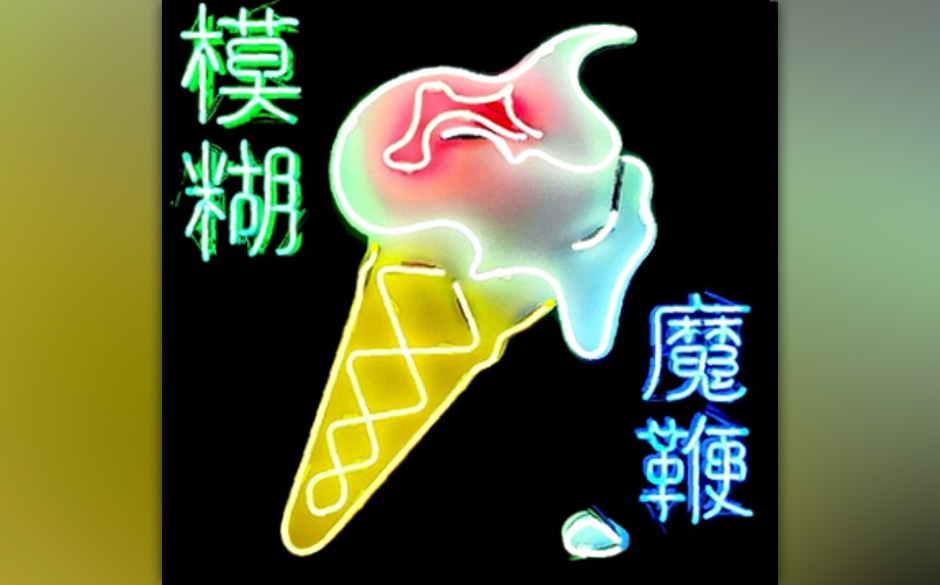Kinks Wer schlafwandelt, kommt besser ans Ziel

Auf einmal sind sie wieder da, die Kinks: „Sleepwalker“, ihre jüngste LP, stand Mitte April bereits unter den ersten Zwanzig der US-Hitliste, in London rockten sie auf der Bühne des „Rainbow“-Theaters, und in Hamburg kletterte Drummer Mick Avory aus dem Flugzeug, um einen Nachmittag lang Interviews zu geben. Zu einem Zeitpunkt, da sich die Small Faces wiedervereinigen, das längst abgeschriebene Trio Emerson, Lake & Palmer auf Tournee geht und drei Urmitglieder der Byrds gemeinsam auftreten, liegt der Gedanke nahe, daß auch die Kinks von den Toten auferstanden sind. Aber das wäre ein Trugschluß: Die Band um den genialen Songautor Ray Davies hat auch in den vergangenen Jahren großartige Platten gemacht und Konzerte gegeben. Nur der Erfolg, der lief ihr nicht mehr nach. Der Umschwung kam erst Ende 1976, als die Kinks die Plattenfirma wechselten.
Einen Vertrag über sechs Langspielplatten mußten die Kinks bei RCA erfüllen. Als sie das geschafft hatten, unterschrieben sie bei Arista, dem Label des von Rockmusikern hochgeschätzten ehemaligen CBS-Topmanagers Clive Davis. Der Wechsel brachte sie schlagartig wieder in die Schlagzeilen und die Hitparaden. „Arista ist eine sehr gute Firma“, sagt Mick Avory und weist besonders auf die künstlerfreundliche Arbeit des Managements und der Promotionabteilungen hin. „Jedem Bandmitglied hat dieser Einstieg Auftrieb gegeben!“
„Sleepwalker“ läßt sich allerdings auch leichter an den Mann bringen als all die anderen Alben, die der Kinks-Kern (Ray Davies, voc und g; Dave Davies, lead—g; Mick Avory, dr) in den siebziger Jahren mit wechselnden Begleitern produziert hat. Bereits im vergangenen Jahrzehnt, als die Band mit den Beatles, den Stones, den Who und anderen zu den tragenden Säulen des Rock zählte und pausenlos Singlehits herausbrachte, entpuppte sich Ray Davies in seinen Songtexten als scharfsichtiger und sozialkritischer Beobachter britischen Alltags; er mokierte sich mit sanfter Ironie über die Dandies und Modepüppchen im „swingenden London“ („Dedicated Follower Of Fashion“ ), beschrieb den beschränkten Horizont des Kleinbürgers („Waterloo Sunset“ ) und schilderte das hoffnungslose Leben von Arbeiterkindern („Dead End Street“ ). Später dann baute er solche einzigartigen Statements zu ganzen Konzept-Alben aus : „Arthur „, „Lola Versus Powerman“ , „Muswell Hillbillies“ , „Everybody’s In Show Biz“ , „Schoolboys In Disgrace“ — alles Platten, die auf den ersten Blick wie schwerverdauliche Brocken wirkten und in die man sich als Zuhörer hineinknien mußte, um ihre tatsächliche Größe erfassen zu können. „Sleepwalker“ ist die erste LP, mit der die Kinks die Konzept-Idee wieder aufgegeben haben zugunsten eines Bündels griffiger, eingängiger, unverbundener Songs (siehe Kritik auf den „Longplayers“-Seiten). Mit solcher Musikware kommt man auf dem internationalen Plattenmarkt natürlich besser an, weil man den Kritikern das Nachdenken erspart, den Radiostationen die ach so geliebten drei-Minuten-Songs liefert und — vor allem — die Werbestrategen innerhalb der Plattenfirma nicht mit intelligenten Geistesblitzen verwirrt.
Die Kinks selbst veranlagten allerdings andere Gründe, die künstlerische Marschrichtung zu ändern. „Die Konzeptidee“ , erklärt Mick Avory, „war eben einfach verbraucht. Und wir wollten als Musiker auch zu unserer ursprünglichen Gruppenform zurückkehren. Wir hatten lange Zeit so viele Leute auf der Bühne, die Sängerinnen und Sänger, die umfangreiche Bläsergruppe. Das kratzte ohne Zweifel an der eigentlichen Gruppenidentität.“
Kopfschmerzen hatten der Band zudem finanzielle Probleme bereitet: Der Versuch, die Konzeptalben als Show auf die Bühne zu bringen, verschlag eine Menge Geld. „Das alles war sicherlich unwirtschaftlich“, meint Mick Avory. „Aber es war den hohen Preis wert.“
Mit einem Hitalbum im Rücken brechen für die Kinks nun wieder andere Zeiten an, besonders in den USA. In den letzten Jahren hatte sich die Gruppe auf Amerika konzentriert und nur noch selten in Europa gespielt. Sie stand eine Ochsentour durch, trat in der Regel mit ihren aufwendigen Shows in sehr kleinen amerikanischen Theatern auf. Nun muß sie umrüsten, sich auf größere Hallen einstellen. Sie tut es mit einem weinenden Auge, weil das Rockgeschäft im Vergleich zu den sechziger Jahren so gigantisch geworden ist und Topstars in den USA fast nur noch vor mindestens zehntausend Zuhörern pro Konzert auftreten. “ So drei— bis viertausend Leute, das liegt uns,“ sagt Mick Avory. „Bei dieser Größenordnung hat man noch ausreichend Kontakt zum Publikum.“
Die Kinks sind geschrumpft; neben den Davies-Brüdern und Mick Avory gehören der Keyboard-Spieler John Gosling und der neue Bassist Andy Pyle zur Stammbesetzung; auf der Bühne mischen zusätzlich nur noch zwei (meiner Meinung nach höchst überflüssige) Background-Sängerinnen und zwei Bläser mit. Das jüngste Konzert in London — das erste nach langer Zeit — vergeigte die Band mit ganz unbritischer Gründlichkeit; so unkonzentriert und chaotisch wie im Rainbow hat sie wohl selten in ihrer langen Karriere gespielt. Zuweilen schien es, als wolle Ray Davies sich selbst und all seine kreativen Höhenflüge mit einer gehörigen Portion Zynismus auf den Arm nehmen. Zuzutrauen wär’s ihm ja.
Ob das Rainbow-Konzert ein Ausrutscher oder doch eine kleine Formkrise war, wird sich im Juni zeigen: Die Kinks kommen nach Deutschland und spielen in Hamburg, Düsseldorf Frankfurt und München.