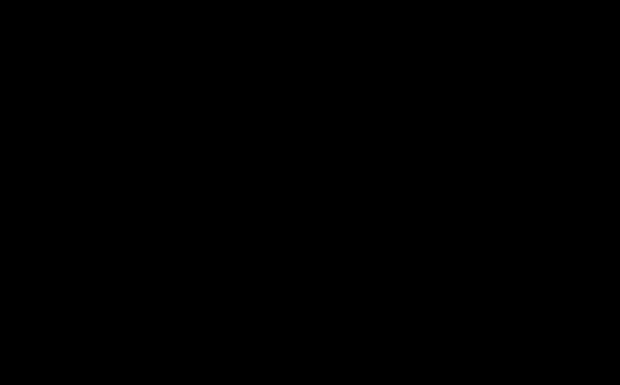Keith Richards

Was 25 Jahre lang als unteilbare Einheit galt, erweist sich nun als ein elektrisches Spannungsfeld zwischen zwei völlig konträren Polen. Mögen die Solo-Aktivitäten von Jagger und Richards musikalisch auch eher mittelmäßig sein – in einem Punkt sind sie überaus erhellend: Nie zuvor wurde derart deutlich, wer der beiden „glimmer twins“ was zum Stones-Sound beitrug. Inzwischen weiß man es. Da ist einmal der „Verkäufer“ Jagger, der auf seinen jüngsten Solo-Tourneen den glatten, gestylten, oft schon gelackten Showman raushängen läßt – und da ist andererseits die ehrliche Haut Richards, die integre Seele des Ladens, der mit unkommerziellem Starrsinn an seinen rostigen Chuck Berry-Riffs festhält. Gab schon Richards‘ erste Solo-LP aufschlußreiche Einblicke in dieses SpannungsVerhältnis, so zeichnet die anschließende US-Tournee ein noch drastischeres Bild. Wer hier einen ’88er Stones-Aufguß erwartete, war völlig fehl am Platz. Während Jagger auf seinen Solo-Tourneen auf Nummer Sicher ging und fast ausschließlich altbekanntes Stones-Material aufpolierte, beließ es Richards bei einigen wenigen, unorthodoxen Reminiszensen („Happy“, „Time Is On My Side“, „Before They Make Me Run“). Stattdessen stand sein eigenes Material im Mittelpunkt – und das war live noch ein ganzes Stück roher, spartanischer, fragmentarischer als schon auf der LP. Zusammen mit den „X-Pensive Winos“ (so der Name seiner Studio-Crew) grub er tief in der grauen Vorgeschichte der Stones und ließ sein Vorbild Chuck Berry auferstehen. Angefangen vom Opener „Take It So Hard“ über „You Don’t Move Me“, seine akustische Ohrfeige für Jagger, bis hin zum Zugaben-Block der 90minütigen Show gab’s rausgerotzten Rock’n’Roll pur, nur gelegentlich angereichert durch eine unaufdringliche Prise Reggae, R ’n‘ B oder Rockabiily. Seine „teuren Saufbrüder“ – Waddy Wachtel an der Gitarre, Charley Drayton am Baß, Ivan Neville an den Keyboards, Richards‘ Co-Autor Steve Jordan an den Drums sowie Saxophonist Bobby Keys und Sängerin Sarah Dash mit Gastauftritten – gaben ihr bestes, um dem hemdsärmligen Unperfektionismus ihres Chefs auch Rechnung zu tragen: Musikalische Fein-Politur war unerwünscht, entwaffende, wenn auch oft etwas holprige Spielfreude wurde hingegen großgeschrieben.
Wie sehr sich Richards im entspannten Kreis seiner Mitstreiter wohlfühlte, war offensichtlich. Wie wenig Talent er zum geborenen/ron/ma/i hat, allerdings auch. Gerade wenn es ans Singen ging, offenbarte Keith sein großes Manko: Diese vom Raucherhusten gequälte Nicht-Stimme mag auf Platte noch charmant wirken – hier auf der Bühne aber fehlt ihr jegliche Zugkraft. Wenn er sich in den Duetten mit der geschulten Stimme von Sarah Dash mißt, wird’s besonders krass. Da tut einem der gute und sicher auch gutmeinende Kerl geradezu leid. (Vielleicht hat er sich deshalb, um allen Vorwürfen den Wind aus den Segeln zu nehmen, auch gleich einen Aschenbecher ans Mikro montiert.)
Fazit: Anders als so viele seiner Altersgenossen wird Keith Richards nie Gefahr laufen, zu einem faden Langeweiler zu degenerieren. Die hemmungslose Spielfreude und die Mißachtung der kommerziellen Spielregeln machen ihn zum ewig jungen Rebellen. Doch ohne den Diplomaten Jagger und seinen mäßigenden Einfluß scheint dieser Rebell nur auf einem Bein zu stehen. Einem Raucherbein obendrein.
Nur allzu oft im Verlauf dieses Konzertes gewinnt man den Eindruck, als lege Keith Richards seine spröden Rhythmustracks aufs Parkett, über die dann gleich – Vorhang auf!-ein gewisser Mick Jagger die Glanzpolitur ausbreiten werde.
Ob es wirklich dazu noch einmal kommen wird, steht in den Sternen. Im Stones-Lager hüllt man sich über den Zeitplan einer möglichen Reunion momentan in Schweigen. Daß Richards‘ Solo-Vergnügen diesen Zeitplan aber über den Haufen geworfen hat, steht außer Frage. Doch diesen Luxus war Keith sich und seiner Selbstachtung wohl dringend schuldig.