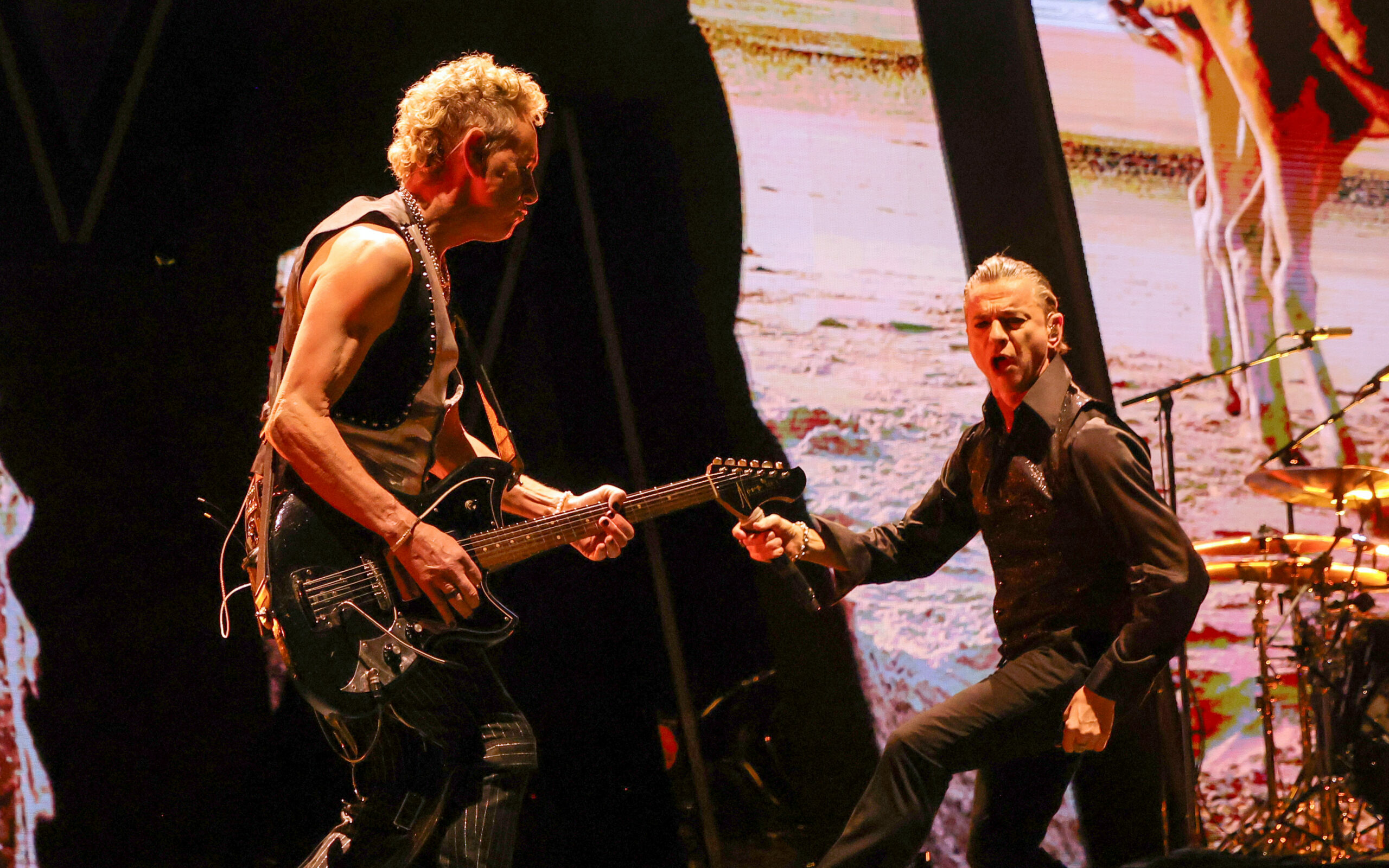GORE IM GLÜCK
Man muss sich Martin Gore als glücklichen Mann vorstellen. Also wirklich: Das muss man sich mal vorstellen, Gore, glücklich. Dafür wurden Depeche Mode doch nicht vor 33 Jahren gegründet. Für die Sehnsucht nach dem Glück vielleicht, doch diese Sehnsucht blieb eigentlich stets unerfüllt in den Liedern von Depeche Mode, die fast alle Martin Gore schrieb und fast alle Dave Gahan sang. Gore und Gahan, was für ein odd couple, Liebe schien es ja nie zu sein, in keiner Hinsicht: der eine (Gahan) der Darsteller der Fantasien, Träume, Albträume des anderen (Gore); der eine (Gore) geschlechtliche Ambivalenz darstellend, der andere (Gahan) gebrochenen Machismo. Man bräuchte für die Projektionen, die zwischen diesen beiden Männern hin- und hergeworfen wurden, die längste Psychoanalytiker-Couch der Popgeschichte. Ja, die 33 Jahre Depeche Mode ließen sich nicht nur als eine endlose Folge von Hits erzählen eines Musikprojekts zwischen Elektronik und, ja, Blues, es ließe sich umgekehrt an 33 Jahren Depeche Mode auch die ganze Identitätskrise des modernen heterosexuellen Mannes erzählen. Andrew Fletcher, der Dritte, stünde dann als weiterer Archetyp des Nicht-mal-Zweifelnden ungerührt daneben, im allerdunkelsten Schatten. Braucht den überhaupt jemand? Das werden sich auch Gore und Gahan schon öfter gefragt haben. Es wäre aber eine so unhöfliche Frage, dass man sie natürlich nicht stellen kann, jetzt, hier, gleich, aus Anlass des neuen mittlerweile 13. Studioalbums von Depeche Mode, DELTA MACHINE: Martin Gore, der Glückliche, steht bereit. Das heißt, er sitzt. In seinem Haus in Santa Barbara, es ist ein weiterer schöner kalifornischer Morgen, die Sonne scheint, zumindest tut sie es auf der Wetterkarte, und in Berlin, wohin Martin Gore nun telefonisch verbunden ist, schneit es fett ins Abendgrau hinein.
Martin Gore, wie geht’s? Und wie geht’s Depeche Mode?
MARTIN GORE: Mir geht es sehr gut, danke. Und als Band sind wir heute sicher glücklicher als je zuvor. Es ist die immer gleiche Geschichte, man wird älter und erwachsener, Prioritäten im Leben ändern sich, und am Ende realisiert man: Viele Dinge, über die wir uns in der Vergangenheit gestritten haben, waren eigentlich völlig unwichtig.
Persönliche Animositäten zum Beispiel?
Na ja, über einen sehr langen Zeitraum haben etwa Dave und Andy sich nicht besonders gut verstanden, doch heute existiert zwischen den beiden eine Art Respekt und Akzeptanz dem anderen gegenüber. Wir sind eine Band, wir sind seit Ewigkeiten zusammen – und mittlerweile haben wir die Tatsache zu schätzen gelernt, dass es uns immer noch gibt. Und dass wir immer noch das tun können und wollen, was wir lieben.
Es fühlt sich also nicht wie ein merkwürdiges Familientreffen an, wenn ihr drei euch nach überstandener Welttour und ein bisschen Erholung voneinander irgendwann im Studio wiederbegegnet?
Eine Einheit, die so lange zusammengehalten hat wie wir, hat damit ja bereits bewiesen, dass sie irgendwie funktioniert. Aber in gewissem Sinne sind wir trotzdem auch so etwas wie eine dysfunktionale Familie, richtig: Es gibt Felder, auf denen wir einfach nicht zusammenpassen. Das rührt jedoch daher, dass wir nun mal alle Künstler sind. Da ist es nur normal, dass jeder von uns auf seine eigene Weise einen leichten Knall hat. Wenn man nun drei Menschen mit leichtem Knall zusammentut, wird es fast zwangsläufig zu, hmm … Unwuchten kommen. (lacht)
Dennoch habt ihr seit SONGS OF FAITH AND DEVOTION den immer gleichen Rhythmus gehalten, alle vier Jahre gibt es jeweils ein neues Studioalbum. Fast wirkt es, als sei das Routine. Oder hat sich am Prozess selbst etwas verändert über die Zeit?
Zunächst mal führen wir drei neben der Band ja auch noch unsere eigenen Leben, da ergibt sich der Abstand der Platten von vier Jahren fast zwangsläufig. Und dann brauchen wir tatsächlich Zeit, um ein Album zu schreiben und aufzunehmen, das unsere eigenen Ansprüche erfüllt. So einen Ein-, Zwei-Jahresrhythmus wie in den 80er-Jahren bekämen wir heute vermutlich gar nicht mehr hin. Außerdem haben sich die Realitäten in der Musikindustrie ja verändert: In diesem Moment, in dem wir beide miteinander reden, bereiten wir uns als Band schon auf unsere Welttour vor, die im Mai beginnt und etwas mehr als ein Jahr dauern wird. In den 80er-Jahren waren wir nie länger als drei Monate unterwegs. Das alles führt zu diesen vier Jahren zwischen den Alben. Tatsächlich ist es so, dass ich immer wieder selbst überrascht bin, wie kurz die Pause zwischen dem jeweiligen Tourende und einer neuen Platte dann ist.
Sonst hat sich nichts geändert?
Eigentlich nicht, nein. Man verändert mal ein bisschen was am Schreibprozess, man verändert mal etwas an den Instrumenten, die man benutzt. Ansonsten ist alles erstaunlich gleich geblieben.
Aber ihr drei redet schon mal vor einer neuen Platte miteinander? Wie die so klingen könnte zum Beispiel? Und wovon die wohl handeln könnte?
Nein, eigentlich reden wir vorher tatsächlich nicht groß. Wir setzen uns nicht etwa zusammen, um den möglichen Sound des Albums vorab zu planen oder Textinhalte und Themen der Songs zu besprechen. Wir lassen den Dingen lieber einfach ihren natürlichen Lauf.
Martin Gore klingt entspannt, locker, zugewandt, im Ganzen fast: amüsiert. Die einfache Erklärung wäre: Es gibt ja auch absolut nichts, worüber er sich beschweren könnte. Man muss sich nur mal kurz seinen Lebensweg vor Augen führen, von Dagenham in Essex nach Santa Barbara in Kalifornien und wer weiß wie oft um die Welt in 51 Jahren; drei Kinder und eine Exfrau und dazwischen der ganze Wahnsinn, die Millionen Platten, die Millionen Fans, die kleinen und die großen Dramen des Lebens. Martin Gore ist, na klar, nicht mehr der gleiche Mann, der vor 29 Jahren das Stück „Somebody“ geschrieben hat, seinen ersten selbst gesungenen Song, eine der klassischen Balladen der 80er-Jahre, deren Text sich heute so brüllnaiv wie anrührend liest: „I want somebody to share /Share the rest of my life /Share my innermost thoughts / Know my intimate details /Someone who’ll stand by my side / And give me support /And in return / She’ll get my support /She will listen to me /When I want to speak / About the world we live in / And life in general.“
Ist es eigentlich auch nach 33 Jahren nicht immer noch merkwürdig, Songtexte in der ersten Person zu schreiben, die dann fast alle jemand anderes singt, nämlich Dave Gahan?
Ich denke darüber gar nicht mehr nach. Über die Jahre ist das zu einer Gewohnheit geworden, und wenn ich heute Lyrics schreibe, dann nur noch mit dem Gedanken, in ihnen ein bestimmtes Gefühl ausdrücken zu wollen. Ich singe den Text auf dem Demo, doch dann ist es völlig natürlich, dass Dave bei den eigentlichen Aufnahmen übernimmt. Er macht sich meine Texte zu eigen. Manchmal hat er eine völlig andere Interpretation des Niedergeschriebenen als ich, dann trägt er die Lyrics sozusagen an einen völlig anderen Ort, der trotzdem hoffentlich noch das Ausgangsgefühl beinhaltet, für das oder mit dem sie mal verfasst wurden. Ich habe aber nicht das geringste Problem damit, dass ich diese Texte dann nicht mehr selbst singe.
Auf DELTA MACHINE singst du von 13 Songs nur einen, „The Child Inside“. Warum ausgerechnet den? Weil dir die Lyrics persönlich näherliegen als bei anderen Liedern? Oder ist das eine eher stimmliche Entscheidung? „The Child Inside“ ist ein langsames Stück, und in der Vergangenheit hast du bei Depeche Mode auch schon meist Balladen gesungen …
Das Merkwürdige bei der Auswahl der Lieder, die ich selbst singe, ist Folgendes: Ich wähle sie gar nicht selbst aus. In der Regel entscheidet Dave, welchen Song nicht er, sondern ich singen soll. Diesmal waren es zwei, neben „The Child Inside“ gibt es auf der Deluxe-Ausgabe des Albums noch einen Song namens „Always“. Als Dave das Demo hörte, sagte er bloß: „Den Song solltest du singen.“ Und ich habe geantwortet: „Okay.“
So einfach.
Ja. Ich gehe nicht ins Studio und verkünde erst mal, welches Lied mir so sehr am Herzen liegt, dass ich es selbst singen möchte. Viele Leute glauben das, doch das ist falsch. Ich erhebe gegenüber meinen Bandkollegen keinerlei Besitzansprüche auf meine Lieder.
Im Text von „The Child Inside“ scheint es um einen Entfremdungsprozess zwischen zwei Menschen zu gehen, die sich mal geliebt haben, und nun erkennt der Ich-Erzähler: Das Kindliche, Unschuldige, Naive vielleicht, das er an der anderen Person einmal geliebt hat, verschwindet zusehends, am Ende stirbt es. Womöglich denkt man deshalb gleich: Ah, das muss etwas Persönlicheres von Martin Gore sein, deshalb singt er die Zeilen selbst. Andererseits: „Goodbye“, ein anderes Lied auf DELTA MACHINE, handelt auch scheinbar von einer Trennung, und das Lied singt nun Dave Gahan, obwohl du es geschrieben hast …
Diese beiden Songs unterscheiden sich für mich sehr voneinander. „Goodbye“ hat einen eher positiv gestimmten Text, der die Überwindung eines Trennungsschmerzes beschreibt, das Loslassen-Können. Es gibt zwei, drei andere Stücke auf dem Album, die ähnlich optimistisch sind, obwohl das rein musikalisch Blues-Songs sind. Doch die Texte sind eben keine Blues-Lyrics, es geht in ihnen nicht um Schmerz und Trübsal. Sie drücken eher aus, dass es mir gerade ziemlich gut geht. „Heaven“ etwa, die Vorabsingle, beschreibt für mich das Gefühl, sich wohlzufühlen in seinem Leben, am richtigen Ort zu sein – glücklich zu sein.
Bist du’s wirklich, Martin Gore? So richtig und echt?
Absolut.
Okay, beim Hören von DELTA MACHINE denkt man auch gleich: angenehm melancholisch, diese Platte, ohne das ganz große Drama, das es auf früheren Depeche-Mode-Alben gab. Das ist ja auch zwischendurch mal schön, nicht?
Ich finde ja einige unsere Alben sehr optimistisch und positiv gestimmt. Aber vielleicht habe ich auch eine andere Vorstellung von Freude einerseits und Melancholie andererseits als ein Großteil der restlichen Menschheit. (lacht)
Depeche Mode werden im Allgemeinen nicht als Gute-Laune-Band verstanden, richtig.
Es mag sein, dass unsere Musik, verglichen mit vielerlei anderer, schon immer melancholischer war. Doch so schreibe ich nun mal: Ich begreife die Welt durch Musik, und die Welt, wie ich sie betrachte, funktioniert nicht in fröhlich stampfenden Dur-Klängen.
Die Welt durch Musik betrachten, da denkt man gleich unwillkürlich an „World In My Eyes“, wo die Welt in der Zusammenkunft zweier Körper betrachtet wird, im Sex der Liebenden: „Let me take you on a trip around the world and back /And you won’t have to move, you just sit still /Now let your mind do the walking and let my body do the talking /Let me show you the world in my eyes.“ Ohne Martin Gore zu wörtlich nehmen zu wollen, denn seine Texte eignen sich dazu ja mitunter eher nicht, hach, die Metaphern sitzen halt auch gerne mal schlecht: Taugen Depeche Mode eigentlich noch zur Betrachtung, nein, zur Beschreibung der Gegenwart? Die buchstäbliche Welthaltigkeit ist Gores Texten ja nun schon länger etwas abhandengekommen, die Introspektion dreht ihre Runden, und wie so oft zuvor schauen auch auf DELTA MACHINE der Teufel und die Engel vorbei. Die Dämonen stecken halt auf ewig in der Seele fest. Wären sie wegtherapierbar, Depeche Mode hätten ihren Daseinszweck verloren. Musikalisch indes klingen sie zumindest irgendwo in der Gegenwart verortet, es krächzen die Synthesizer, die Sub-Bässe bumpern, und die Rhythmen stolpern ein bisschen hin und wieder. Aber nicht so sehr, dass es peinlich ranschmeißerisch würde, der Dubstep bleibt schön den jungen Leuten da draußen überlassen. Aber für wie zeitgenössisch hält Martin Gore sich und seine Band denn noch?
GORE: Depeche Mode haben mal begonnen als eine Band, die neuen musikalischen Boden betreten hat, wir waren ja nun eine der wenigen elektronischen Bands, die es gab Anfang der 80er-Jahre. Obwohl wir uns nicht als Pioniere fühlten, waren wir es auf eine Weise dann doch. Heute hat sich elektronische Musik natürlich längst durchgesetzt. Sie ist Mainstream.
Wohin hat sich dann der Fortschritt verzogen? In die Hard-und Software?
Ich für meinen Teil bin Techniknerd, noch immer. Ich kaufe bis heute ständig haufenweise neue Geräte und Software, ich versuche, mich auf dem aktuellen Stand zu halten.
Und bei der Musik?
Meinst du, was ich so höre? Alle möglichen Arten von Musik, sowohl alte als auch neue elektronische. Ich glaube daran, dass die jeweiligen Hörgewohnheiten sich in der eigenen Arbeit niederschlagen, insofern merkt man das, glaube ich, auch meinen Songs an. Aber ich höre Musik nie in dem Sinne, dass ich nach etwas Neuem suche, das mich begeistert und das ich dann nachbauen wollen würde. Ich lasse mich von neuen Releases nicht in dem Sinne erschüttern, dass ich mein eigenes Tun davon tatsächlich beeinflussen ließe. Ich hielte das auch für grundfalsch. Ich versuche vielmehr, die Musik anderer einfach zu genießen. Derzeit etwa Chimes &Bells und First Aid Kit, aber auch haufenweise neuen Techno und alten Blues und Country. Ich finde einfach, dass man als Songwriter einen anständigen Überblick haben muss, auch über die Musikgeschichte.
Auf zwei Songs der neuen Platte hört man eine Gitarre, die sehr bluesig klingt. Der Widerspruch zwischen natürlichen und elektronischen Instrumenten ist ja längst aufgelöst. Als ihr 1989 „Personal Jesus“ veröffentlicht habt, war das ein Schock für viele Leute.
Ich mag die Idee eines elektronischen Blues jetzt schon eine ganze Weile, nicht erst seit VIOLATOR, sondern vermutlich schon früher. Und auf dem neuen Album gibt es wieder ein paar sehr bluesige Tracks. Deswegen auch der Titel DELTA MACHINE – obwohl wir kein wirkliches Blues-Album machen wollten und auch nicht gemacht haben, natürlich nicht.
Wie offen ist der musikalische Prozess bei Depeche Mode denn noch?
So offen wie früher auch schon. Ich komme mit meinen Demos ins Studio, und ab da arbeiten wir gemeinsam an den Tracks. Bei diesem Album hat es mich selbst überrascht, dass alle anderen bereits den Sound meiner Demos mochten, Dave und Andy ebenso wie unser Produzent Ben Hillier und Daniel Miller, der ja seit dem ersten Tag von Depeche Mode so etwas wie unser Mentor ist. Bei früheren Alben war es zwar durchaus so, dass die anderen meine Songs mochten …
… aber nicht, wie sie klangen?
Könnte man so sagen. Diesmal ergab sich bereits aus dem Sound der Demos ein gemeinsamer Ansatz, und überraschend viele Elemente von ihnen sind am Ende fast unverändert auf der Platte gelandet. Das bedeutet nicht, dass die Tracks nicht erheblich verbessert wurden während des Aufnahmeprozesses (lacht) … Aber ihr Sound und ihr Grundgefühl, um es mal so zu nennen, sind weitgehend erhalten geblieben.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn du Dave Gahan und Andy Fletcher deine Demos vorspielst – läuft das wie eine interne Firmenpräsentation ab? Und womit kommst du da an? Nicht mehr nur mit Kompositionen auf Gitarre oder Klavier, mit Songskizzen also, sondern mit fertig programmierten Tracks?
Ich beginne zwar das Schreiben bis heute noch oft an der Gitarre oder am Klavier, doch dann arbeite ich die Kompositionen in meinem eigenen Studio weiter aus. Das ist so ordentlich ausgestattet mittlerweile, dass ich ganz okaye Versionen der Tracks allein anfertigen kann.
Du nimmst den anderen beiden die Arbeit ab? Oder stellst du auf diese Weise sicher, dass Dave Gahan und Andy Fletcher gar nicht erst groß Ideen entwickeln, deine Songs umzukrempeln?
(lacht) Nein, nein, das ist schon ein von gegenseitigem Respekt geprägter Prozess bei Depeche Mode.
Bei DELTA MACHINE wird in den ersten drei, vier Songs der Sound und das Tempo des Albums etabliert, es gibt viele Midtempo-Nummern und relativ viel elektronisches Knarzen, aber ohne dass Letzteres tatsächlich aggressiv klänge.
Wir haben viele modulare Synthesizer benutzt, meist moderne Eurorack-Teile. Man kommt mit denen schnell ins Klangexperimentieren, und die Sounds, die dabei entstehen, sind tendenziell eher grob.
Lass uns für einen Moment pophistorisch werden – wie verhält sich deiner Ansicht nach DELTA MACHINE zum Gesamtwerk von Depeche Mode?
Nun gut … Bei der Pressekonferenz, die wir anlässlich des neuen Albums und der anstehenden Tour gegeben haben, habe ich gesagt, dass ich mich bei zwei, drei Tracks an VIOLATOR und an SONGS OF FAITH AND DEVOTION erinnert fühle. Aber dieser Kommentar war wohl ein Fehler, er wurde gleich heiß diskutiert, und wenn die Leute dann erst mal das neue Album hören können, werden sie sich fragen: „Was zur Hölle hat Martin Gore da gemeint? Musikalisch hat das doch gar keine Ähnlichkeiten mit diesen beiden Alben!“ Ich wollte lediglich ausdrücken, dass mich einige der mehr elektronischen Tracks auf DELTA MACHINE an VIOLATOR erinnern, während die etwas rockigeren mich eben an SONGS OF FAITH AND DEVOTION erinnern. Mehr wollte ich gar nicht sagen.
Dann wählen wir doch einen anderen, weniger die Orthodoxie der Depeche-Mode-Lehre provozierenden Ansatz der Einordnung: Es ist das dritte Album in Folge, das Ben Hillier produziert hat.
Richtig. Für mich fühlt es sich an, als ob wir mit ihm durch einen Weiterentwicklungsprozess gegangen sind, obwohl sich die drei Alben musikalisch voneinander deutlich unterscheiden. Jedenfalls: Ich mochte diesen Prozess mit Ben.
In diese Zeit fällt auch das einzige Stück, das du je mit Dave Gahan gemeinsam geschrieben hast, „Oh Well“ war auf der Deluxe-Ausgabe der letzten Platte SOUNDS OF THE UNIVERSE. Warum vermeidet ihr beide diese Art der Zusammenarbeit eigentlich so hartnäckig?
Es gibt jetzt noch einen weiteren Song, er heißt „Long Time Lie“ und wird auf der Deluxe-Ausgabe von DELTA MACHINE sein. Dieses Stück haben wir tatsächlich zusammen geschrieben, während „Oh Well“ ursprünglich von mir mal als Instrumental-Technotrack gedacht war, zu dem Dave dann von sich aus einen Text verfasst und den über den fertigen Track gesungen hat. „Long Time Lie“ war auch wieder als Instrumental angelegt, und Dave hat wieder Lyrics dazu geschrieben – denen ich dann aber anschließend noch eigene Passagen hinzugefügt habe. Das war also eine noch viel gemeinsamere Arbeit, wenn man so will.
Das heißt, ihr habt hintereinander, aber nicht miteinander am selben Track gewerkelt. Das ist ja doch nicht das, was man im engeren Sinne unter Zusammenarbeit versteht. Sich einfach mal gemeinsam hinzusetzen und zu schreiben – das vermeidet ihr weiterhin?
Na ja, wir reden immer wieder darüber, ob wir das nicht mal machen sollten. Doch wenn Dave Songs schreibt, tut er das immer mit anderen Leuten als mir.
Bei diesem Album ist das der Schweizer Musiker Kurt Uenala. Fürchtet sich Dave Gahan einfach vor dir als Songwriter-Partner?
Ich weiß es nicht. Aber beim nächsten Album sollten wir es mal zusammen probieren.
Ernsthaft?
Ernsthaft.
Albumkritik S. 81
Sichern Sie sich jetzt Ihren persönlichen Zugang: www.musikexpress.de/das-archiv