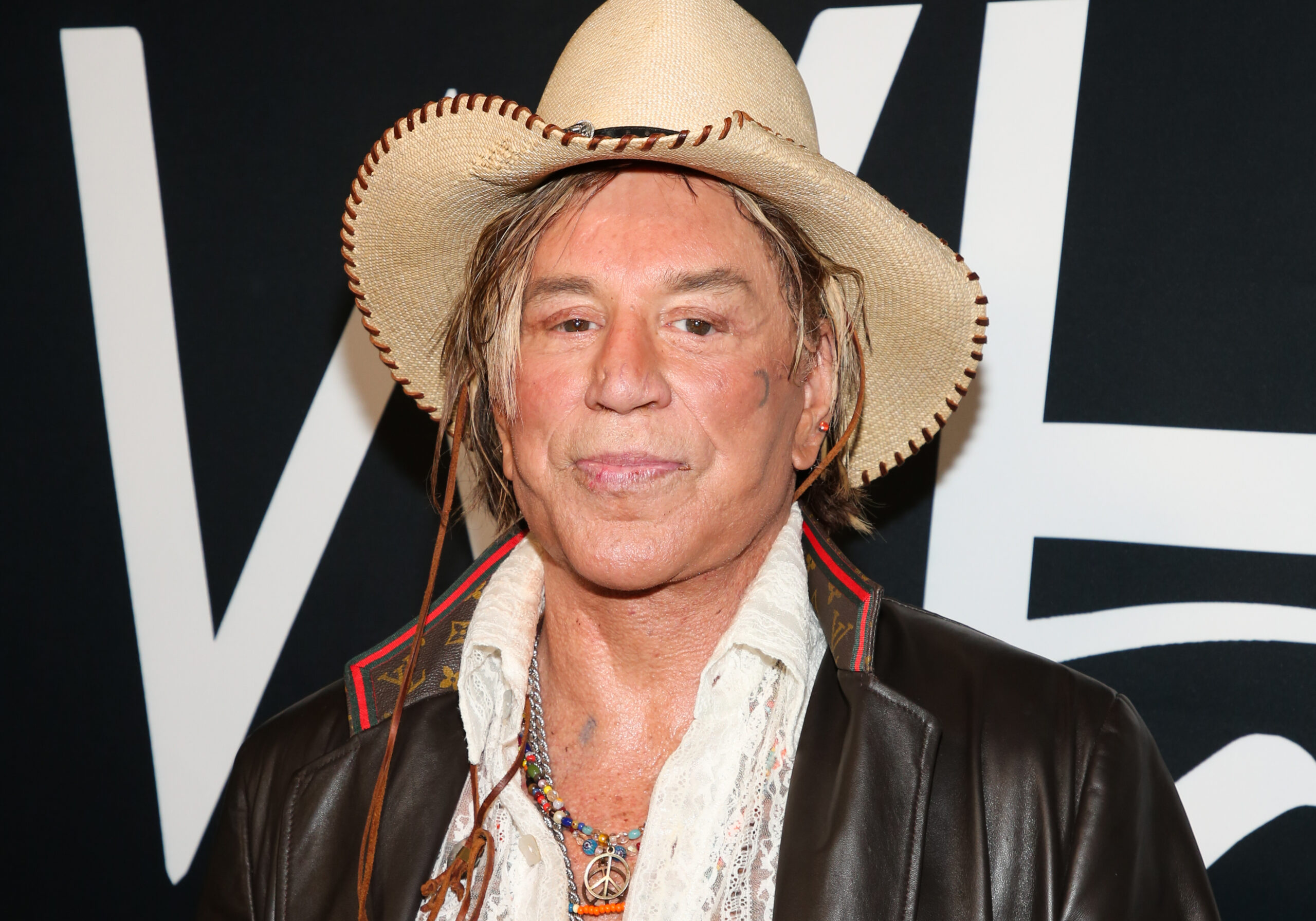Denzel Washington
Man nennt ihn auch Chamäleon. Denzel Washington hat sich mit perfekter Wandlungsfähigkeit zum Topstar hochgespielt. Nachzuprüfen in zwei neuen Filmen: „"Philadelphia" und „"Die Akte"

Auf Hollywoods sogenannter A-Liste findet sich immer mal wieder einer, der sich geschickt jedem Raster entzieht und aus der Image-Falle ausbüchst. Denzel Washington gehört zu dieser raren Spezies. Er ist weltberühmt – längst hat er Eddie Murphy in der Position des größten dunkelhäutigen Stars beerbt. Er ist begehrt – bei wichtigen Regisseuren und beim Publikum gleichermaßen. Und er hat neben dem kommerziellen offenbar auch den künstlerischen Erfolg gepachtet – dreimal schon wurde er für den Oscar nominiert, den er 1990 für seine Darstellung eines Sklaven im Bürgerkriegsdrama „Glory“ auch gewann.
Aber Preise hin, Power her – dieser Mann ist nicht zu fassen. Das fängt im Kino an, wo man sich bei Denzel Washington immer auf eine Überraschung gefaßt machen muß. Ein Blick auf die letzten drei Filme, abgedreht im rekordverdächtigen Tempo eines knappen Jahres: Erst gab er in der flotten Shakespeare-Verfilmung „Viel Lärm um nichts“ einen italienischen Edelmann. Und ab sofort ist er nicht nur neben Tom Hanks in „Philadelphia“, dem ersten AIDS-Drama Hollywoods zu sehen, sondern ein Kino weiter auch noch als Partner von Julia Roberts im Grisham-Thriller „Die Akte“ (s. Foto). Gemeinsamkeiten der Stoffe? Keine. Außer: Jede der drei Rollen, die Washington nun so komplett ausfüllt, als hätte es dafür nie andere Kandidaten gegeben, wurde ursprünglich für einen Weißen geschrieben. Und natürlich nennen sie ihn in der Branche „das Chamäleon“.
Auch als „schwarzer Robert De Niro“ oder gar „männliche(r) Meryl Streep“ wird er seiner Verwandlungsfähigkeit wegen bezeichnet. Und tatsächlich geht Washington, 40, den Job mit ebenso perfektionistischer Verbissenheit wie die beiden Schauspiel-Vorbilder an: „Ich arbeite seit zwanzig Jahren jeden Tag hart daran, ein guter Schauspieler zu sein. Denn ohne hartes Training kann man es in keinem Geschäft zu etwas bringen.“ Für sein Debüt, den Apartheidsfilm „Biko“, futterte sich Washington mal eben dreißig Pfund Übergewicht an. Für den Krimi „The Mighty Quinn“ legte er sich einen jamaikanischen Akzent zu, der so präzise gelang, daß er nachher für den US-Markt wegsynchronisiert (!) werden mußte. Für „Mo‘ Betta Blues“ lernte er, auf einer Trompete zu spielen. Und für sein vielgepriesenes Porträt von „Malcolm X“ studierte er ein halbes Jahr den Koran. Wieviel bei dieser intensiven Vorbereitung noch von der Persönlichkeit Denzel Washingtons auf der Leinwand zu sehen ist? „Überhaupt nichts“, gibt er unmißverständlich zu, „denn es geht doch niemand ins Kino, weil er etwas über mich und über mein Innenleben erfahren will.“
Viele Interviewer haben sich an ihm schon die Zähne ausgebissen, denn hilflose Deutungen seiner Person läßt er abtropfen wie Wasser. Stichwort Sex-Symbol: „Dieser Begriff fällt ausschließlieh, wenn mich die Presse einzuordnen versucht. Aber auf der Straße ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, mir erotische Ausstrahlung zu unterstellen.“ Ruhm? „Meine Frau würde sich kaputtlachen, wenn ich mich plötzlich für bedeutsamer als, sagen wir, unseren Klempner hielte.“
Legt die Vermutung nahe: Denzel Washington hat überhaupt nichts brennend Interessantes und Rätselhaftes zu verbergen. Ganz im Gegenteil: Der Mann ist stinknormal.
So gibt es in Denzel Washingtons Leben nur eine wirkliche Konstante, nämlich „meine Familie“. Seine Frau Polette Pierson, eine Malerin, kennt er seit Kindheitstagen. Und sein spektakulärstes Freizeitvergnügen besteht darin, den ältesten Sprößling als Baseball-Coach zu betreuen. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, daß er „die Werte der familiären Einheit“ mit fast missionarischem Eifer anpreist. Zugegeben, das ist seine Sache. Doch wenn er, um seinen Punkt klarzumachen, über Dinge spricht, die die familiären Idyllen in der Welt bedrohen, klingt das verdammt reaktionär. So verabscheut er Gewalt und hält einen harten Ghetto-Film wie „Menace II Society“ oder wütende, militante Rap-Bands allen Ernstes für gefährlich: „Mit der Gewalt ist es wie mit Pickeln. Wenn man sich schlechtes Essen reinstopft, platzt es irgendwann in deinem Gesicht wieder heraus. Und wenn man die Kids mit Gewalt füttert, darf man sich nicht wundern, wenn sie explodieren.“
Und das aus dem Munde des Mannes, der „Malcolm X“ gespielt hat. Vielleicht ist es ganz gut, daß er bevorzugt seine Kino-Leistungen für sich sprechen läßt.