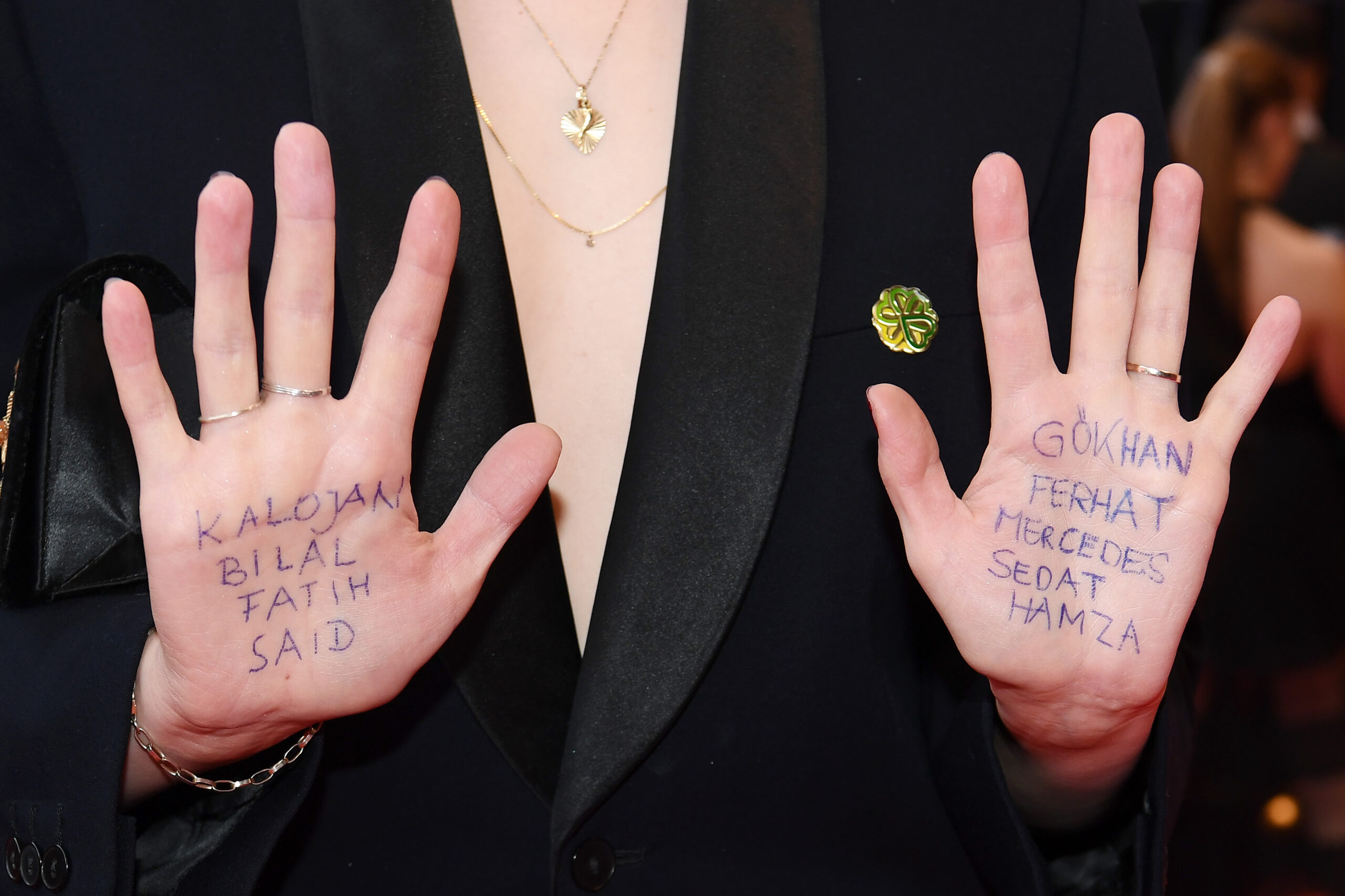Bob Marley in Jamaika: Roots, Rocks, Reggae
Jamaikas Hauptstadt Kingston besitzt zwei bedeutende Gettos. Das eine bilden die Hotels Sheraton und Intercontinental, wo der weißhäutige Gast aus Europa oder den USA Schweizer Müsli oder amerikanische Steaks ißt und sich in unterkühlten, vollklimatisierten Räumen von abgewichster abendländischer Barmusik unterhalten läßt. Das andere heißt Trenchtown, ist eine ausgedehnte Bretterbudenstadt inmitten von Downtown-Kingston und wird bewohnt von Leuten, die nichts mehr zu verlieren haben. Nein, durch Trenchtown wollen die einheimischen Taxifahrer den Gast aus Europa nicht einmal nonstop hindurchchauffieren, bei geschlossenen Fenstern, versteht sich.
Trenchtown war die Keimzelle des Reggae, jener farbigen Musik, die in den letzten Jahren die Welt bereichert und den Rock erobert hat wie vor ihr nur der Blues. Trenchtown ist aber auch der Ort, an dem sich die sozialen Spannungen entladen, die Jamaikas großes Problem der siebziger Jahre bilden: Weil der in bislang zwei ordentlichen Wahlen siegreiche Premierminister Michael Manley einen gemäßigten Linkskurs steuert, holen internationale Konzerne aus der Insel raus, was rauszuholen ist, schafft die jamaikanische Oberklasse ihre Vermögen ins Ausland, fehlt der karibischen Sonneninsel an allen Ecken das Geld für Investitionen, Arbeitsplätze, sozialen Fortschritt. Seit Jahren erschüttern Kingston daher Unruhen, tobt in Trenchtown ein unheimlicher Krieg, der manchmal sehr grausame Züge zeigt: Leute werden umgelegt, ganze Familien liegen morgens mit durchschnittenen Kehlen in ihren Hütten.
Pistolenhelden
Die Drahtzieher dieser zuweilen an nordirische Bürgerkriegsszenen erinnernden Auseinandersetzungen kommen aus feinen Kreisen – sie stammen aus den Leibwächtertruppen der beiden führenden Politiker Jamaikas. Für Premierminister Michael Manley und Oppositionsführer Edward Seaga ist der Terror natürlich nicht eine erwünschte Fortsetzung ihrer Politik mit anderen Mitteln. Aber irgendwann geriet die traditionelle Feindschaft zwischen ihren Parteien (Manley’s „Peoples National Party“ und Seaga’s „Jamaican Labour Party“) wohl außer Kontrolle, und fortan sorgte das soziale Elend in den Bretterbuden dafür, daß immer wieder Messer- und Pistolenhelden nachwuchsen, die glaubten, nur das schmutzigste aller Geschäfte könne ihre Lage verbessern.
Eines Tages allerdings, vor ein paar Monaten, beschloß die jamaikanische Nation, sich an den eigenen Haaren aus dem Dreck zu ziehen. Ein unerhörtes und ein historisches Ereignis, wenn man bedenkt, daß Hitler-Deutschland nach 1945 von den Amerikanern mit Gewalt umerzogen werden mußte und die Nordiren trotz vieler Versuche noch immer nicht soweit sind, vom Wahnsinn des Bürgerkrieges abzulassen. In Kingston nutzte ein Haufen weiser Leute ein günstiges Vorzeichen: bei der Beerdigung eines prominenten Mordopfers hatten zwei Anführer der verfeindeten Lager, Claudius Massop und Bucky Marshall, am Grabe einträchtig zusammengestanden. Vor allem Rastas, Angehörige der wichtigsten und eigenständigsten religiösen Gruppierung Jamaikas, gehörten zu den Begründern der Friedensbewegung, die den aus dem Grabe gestiegenen Geist der Versöhnung nicht davonflattern lassen wollte. Als Krönung ihrer Bemühungen, die schnell von der Mehrzahl der etwas über zwei Millionen Einwohner der Insel aufgegriffen wurden, sollte ein „peace concert“ im großen Stadion von Kingston in Szene gesetzt werden – mit den besten Reggae-Interpreten des Landes, Bob Marley und die Wailers eingeschlossen.
Killertrupp
Das Angebot an Marley, für den Frieden zu rocken, war ein gewagter Vorstoß. Denn im Dezember 1976 hatte der Rastamann seine Heimat verlassen – nach einem Attentat, dessen Umstände nie ganz geklärt wurden. Eine Rolle spielte damals aber wohl die Tatsache, daß kurz vor allgemeinen Wahlen das – falsche – Gerücht umlief, Marley wolle sich ausdrücklich für Premier Michael Manley einsetzen. So zog ein Killertrupp los zu Marleys Haus an der Hope Road in Uptown-Kingston. Wie durch ein Wunder wurde Bob durch Streifschüsse nur leicht verletzt. Seine Frau Rita dagegen bekam eine ganze Ecke mehr ab, und Manager Don Taylor schwebte im Krankenhaus eine Zeit lang zwischen Leben und Tod.
Hope Road Nummer 56, Ende April 1978: Kaum zu glauben, daß hier jemals Blut floß. Marley ist wieder da, die Lage ist cool, und der Rastamann lächelt. Sein Haus, früher einmal das Office der britischen Plattenfirma Island, ist ein Tag vor dem peace concert ein offenes Haus: Jede Menge Rastas hängen hier rum, zwei Vertreter der Friedensbewegung erläutern Journalisten aus der halben Welt ihr Programm, Marley und einige Mitglieder seiner Band, der Wailers, haben Zeit für Interviews oder einen Schnack im Schatten immergrüner subtropischer Bäume. Der Geist des Friedensfestes ist eingekehrt: „One Live“ und „Tribal War Is Over“ sind die Schlagworte der Stunde in Jamaika, ein Dutzend Songs zu diesem Thema gibt es bereits als Platte. (Wer in diesem Sommer nach London kommt und in jamaikanischen Plattenshops in Notting Hill mit viel Glück die Singles „Tribal War Is Over“ von George Knooks, John Holt oder Dillinger und „Peace Treaty Special“ von Jacob Miller findet, sollte diese wunderbaren Songs auf jeden Fall mitnehmen).
Friedlich ist auch die Stimmung im Stadion von Kingston,
als am 22. April gegen 18 Uhr das Festival beginnt. Dramatische Ereignisse passieren erst gegen Ende des achtstündigen Reggae-Rausches, obwohl irgendetwas Großes zweifelsohne in der Luft liegt. Einen kleinen Vorgeschmack dazu hatte Mutter Natur schon ein paar Tage zuvor geliefert, als Bob Marley aus dem Exil in London und Miami nach Jamaika heimkehrte. Just in jener Stunde, da er den Norman Manley International Airport in Kingston erreichte, erschütterte ein leichtes Erdbeben die Insel – dies ist bei Gott kein Witz, sondern eine Tatsache, die man in der Zeitung nachlesen konnte.
Vollmond
Knapp 30.000 Leute bevölkern am großen Tag des Friedens das Stadion. Setzt man diese Zahl einmal in Bezug zur gesamten Einwohnerzahl Jamaikas, dann hätten nicht 400.000 sondern 3,3 Millionen Amerikaner zum Festival in Woodstock kommen müssen – das wäre exakt der gleiche Prozentsatz gewesen. Fast alle Reggae-Interpreten, die auch außerhalb Jamaikas einen Namen haben, schütteln im Verlauf des achtstündigen Festivals ihre Rasta-Locken. Und die aus Europa für sieben Tage „Roots“-Studium eingeflogenen Rock-Journalisten fragen sich wieder einmal verzweifelt, wie eine so kleine Insel bloß eine derartige Kreativitätsflut hervorbringen kann.
Das Programm läuft stundenlang fast ohne Pause; die großartige Band We The People klinkt sich nimmermüde auf immer neue Sänger ein. Der Reggae-Rhythmus törnt immer mehr an, je länger Baß und Schlagzeug, Gitarren und Orgel und ab und zu auch beseelte Bläser ihre „positive vibrations“ verbreiten. Die Luft ist warm und milde, auch nach Einbruch der Dunkelheit; ein weißer, gleißender Vollmond steht am Himmel und unterstützt die Lichtbündel, die sich auf der Bühne in den Augen des Löwen von Juda, der symbolischen Gottfigur der Rastas, treffen.
Dillinger erscheint, jener Mann, der mit seinem Reggae-Song „Cocane In My Brain“ monatelang in den deutschen Top 50 stand und in Holland sogar Platz eins schaffte. Auf dem Kopf trägt Dillinger sein Markenzeichen, die überdimensionale Kappe, und am Leibe einen grün/rot/gelb gestreiften Anzug, in den Nationalfarben Äthiopiens also, des gelobten Landes der Rastas. Der Cocane-Mann hat das Stadion mit zwei Handbewegungen und einem Grinsen auf seiner Seite, und das zu recht: Selten sah ich einen Alleinunterhalter aus dem Rockgeschäft, der soviel Lust und gute Laune in den Leuten weckte und ihnen im typischen Rasta-Kauderwelsch auch noch ein paar Gedanken mit Tiefgang mitlieferte.
Heiterer Umbau
Althia & Donna treten auf, singen „Up Town Top Ranking“ mit neckischen Kieksern. Michael Leckebusch wollte die beiden Mädchen vor Wochen in den TV-„Musikladen“ holen, weil ihr Song sich hier zulande zu einem mittleren Hit entwickelte. Indes: Kein Mensch wußte, wo sie steckten; der einzige, der sie auf Jamaika, wo sonst – fand und ihnen einen Plattenvertrag unter die Nase hielt, war „Virgin“-Plattenboß Richard Branson. Nun haben WEA und Lightning Records, die mit Althia & Donna Anfang 1978 den Spitzenplatz der britischen Charts besetzten, das Nachsehen. Aber im Showbusiness auf Jamaika macht nun einmal das Rennen, wer am schnellsten schaltet und sich am wenigsten um Copyrights kümmert – das rechtliche Chaos in der Reggae-Szene der Insel ist ebenso unglaublich wie einmalig.
Irgendwann wechselt im Stadion die Band, und die zwanzig Minuten Umbau überbrückt – undenkbar in Deutschland – ein Mensch namens Prince Edwards, Moderator, Büttenredner, Komiker in einer Person. Der Mann ist so gut, daß sich 30000 Leute etliche Male die Bäuche halten vor Lachen – als ob der ganze Reggae-Taumel nicht schon schön genug wäre. Prince Edwards Lieblingsthema sind die Engländer, die einstige Kolonialmacht in Jamaika. Wenn man das Vereinigte Königreich betreten will, doziert der Prinz mit spitzer Zunge, muß man ja bis zum Erbrechen die höchst überflüssige „Immigration Card“ ausfüllen. „Sex“ (Geschlecht) steht da irgendwo am rechten Rand. Was soll man da eintragen, fragt sich der Prinz. Zum Beispiel dies: 3 mal letzte Nacht, 2 mal heute morgen.
Heilkraut
Als Jacob Miller mit der Band Inner Circle auf die Bühne tanzt, erhält das Festival eine ernstere Dimension. Denn inzwischen sind Premier Manley und Oppositionschef Seaga mit Gefolge eingetroffen und haben ganz vorne, ein paar Schritte nur von der Bühne entfernt, Platz genommen. Jacob Miller, dieser flinke Buile, den vermutlich nur ein Meat Loaf aufs Kreuz legen kann, schüttelt wild die Rasta-Mähne und schnellt mit staksigen Sprüngen über die Bühne, während hinter ihm die Inner Circle eine umwerfende Mischung von Rock und Reggae loslassen. Dann springt dieser Miller plötzlich von der Bühne, pirscht sich an den erstbesten der nach „Star Wars“-Muster behelmten Polizisten heran und bietet ihm einen Joint an. Marihuana, auch Ganja, Kaya und Herb genannt, ist ja für die Rastas bekanntlich das Heilkraut der Völker. Stattdessen lehnen sie schnöde Tabak-Zigaretten und Alkohol ab – aber legal ist der Anbau von Ganja in den Bergen Jamaikas deswegen noch lange nicht. Dem armen Polizisten begegnet also die große Versuchung; ein Blick aus den Augenwinkeln eines nahestehenden Vorgesetzten bringt ihn indes dazu, Jacob Miller abblitzen zu lassen. Der allerdings packt nun den Polizeihelm, zieht ihn seinem Gegenüber vom Kopf, stülpt ihn auf die Rastalocken und klettert triumphierend auf die Bühne zurück. Wild rast er über die Bretter, pafft in großen Wolken Ganja, und das Stadion jubelt. Die Polizei indes bleibt cool, und meines Wissens sitzt Jacob Miller heute wegen dieser Untat keineswegs im Gefängnis. Was wäre, wenn Udo Lindenberg . . .? Nein, lieber nicht. Denk‘ ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um meinen Schlaf gebracht.
Peter Tosh, ehemaliger Sideman von Bob Marley, hat auch Ganja zum Thema der Nacht erkoren. Von der Creme der jamaikanischen Sessionmusiker begleitet, bettet er in eine brillante Mischung aus Reggae und Jazzrock seine Klagen über wirtschaftliche und soziale Mißstände in seiner Heimat. Auge in Auge mit dem Premierminister macht sich Tosh mit einem Schwall schlimmster Schimpfworte Luft und prangert die schmutzigen politischen Geschäfte an. Dann singt er „Get Up, Stand Up“, ein rebellisches Lied, das er zusammen mit Bob Marley komponiert hat. Und schließlich, so kurz nach Mitternacht, fragt er den Premier, wieso eigentlich nicht das wunderbare jamaikanische Ganja legal angebaut werden könne, um damit die Welt zu versorgen. Herausgeschmuggelt aus Jamaika würde der Stoff ohnehin – Amerikas 40 Millionen Marihuana-Raucher brauchen Nachschub -, und die dicke Mark machen würden dabei Ausländer. Ein Spinner, dieser Tosh? Von wegen: alles was er sagte, berichtete ein paar Tage später ungekürzt und unverfälscht „The Jamaica Daily News“, eine der großen Tageszeitungen der Insel. Die Schlagzeile über diesen Artikel: „Unsere sozialen Krankheiten aus der Sicht von Peter Tosh.“ Das ist Jamaika, Mann.
Bob Marley ist der Headliner des Festivals. Mit den Wailers und den I-Threes, den Chorsängerinnen, spielt er ausschließlich Songs, die direkt mit Jamaika und der Religion der Rastas zu tun haben: „Natty Dread“, „Positive Vibration“, „Natural Mystic“, „Jamming“, „Jah Live“ und der Titelsong des Friedensfestes, „One Love“ (enthalten auf der LP „Exodus“). Mehr denn je wirkt Marley wie in Trance, scheint er gepackt von missionarischem Eifer. Gegen Ende seines Auftritts passiert dann das Unglaubliche: Oppositionschef Seaga wird auf die Bühne geholt, danach Premierminister Manley. Bob Marley legt ihre Hände ineinander, legt seine Hände dazu, die farbigen Spotlights krallen sich in diesen Händen fest, so daß jeder sehen kann, was geschehen ist.
One Love
One Love. Der Krieg ist zuende. Hoffentlich. Nie zuvor hat irgendwo auf der Welt eine Spielart des Rock eine solche Bedeutung im Leben eines Volkes erlangt. Kubanische und amerikanische TV-Kameras filmen das Ereignis. Nach der großen Friedensgeste umfassen sich Politiker, Musiker und Leute der Friedensbewegung und versuchen, zum Reggae gemeinsam zu tanzen. Die Wailers spielen noch immer in dieser Vollmondnacht. Die beiden kleinen Söhne von Bob Marley kommen auf die Bühne und tanzen wie Profis. Zwischen Premier Manley und Oppositionschef Seaga tanzt, Arm in Arm mit beiden Politikern, Bucky Marshall, der zu den Köpfen der Killerbanden gehört. Bucky Marshall heult. Man sieht es noch aus hundert Metern Entfernung.