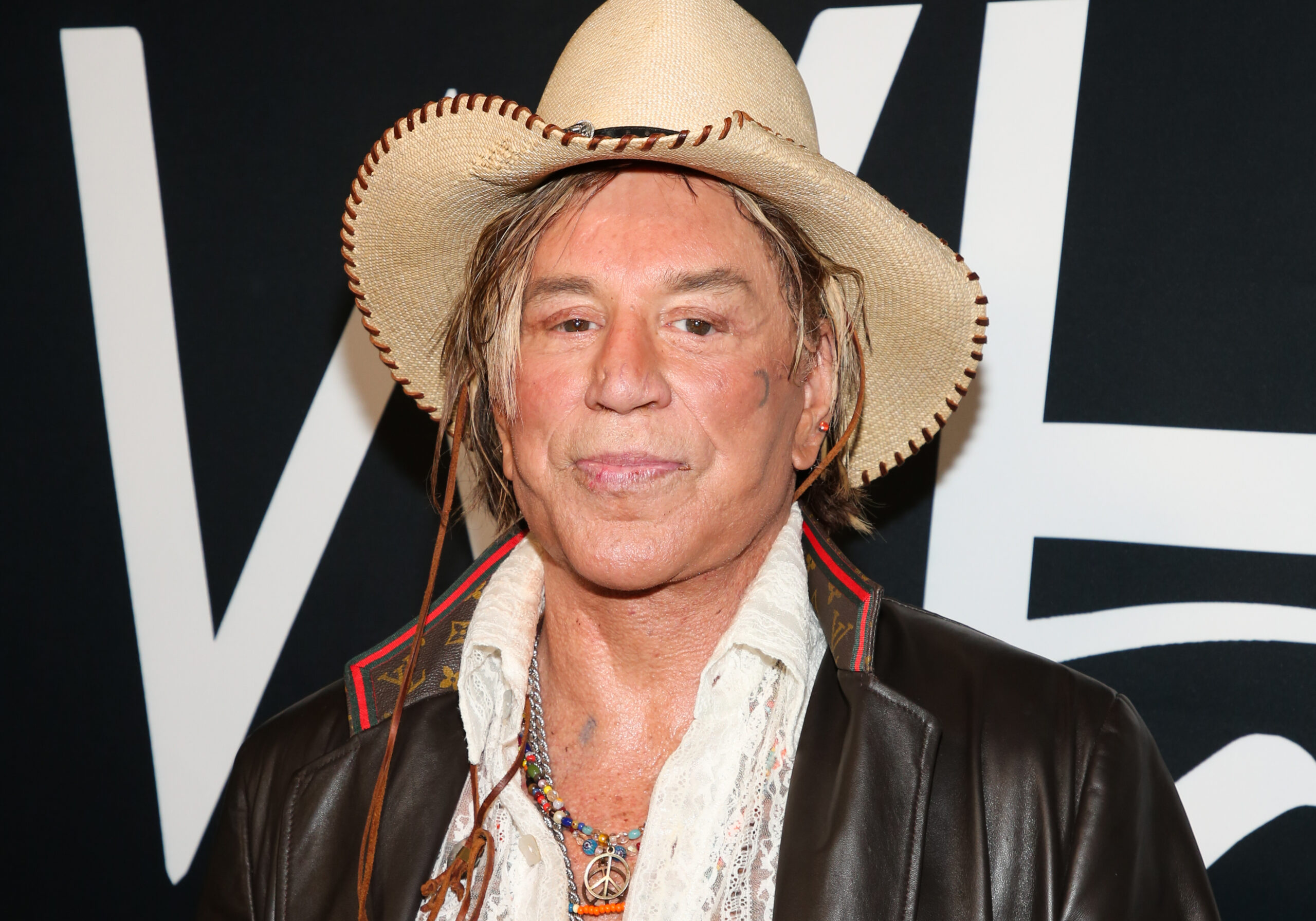Ja, Panik
DMD KIU LIDT
Staatsakt/Rough Trade VÖ: 15. April 2011
Vertreter deutschsprachiger Musik: alle mal hinten anstellen, alle. Das vierte Album der Gruppe Ja, Panik.
So weit war der Weg gar nicht, den die Österreicher seit ihrer ersten Inkarnation als Flashbax zurückgelegt haben. Zumindest war er nicht so weit, sind die Unterschiede zwischen den beiden Bandversionen – abgesehen von zahlenmäßig überschaubaren Änderungen in der Besetzung – nicht so gravierend, dass Ja, Panik derart beschämt auf ihr früheres Leben zurückblicken müssten wie sie es heute tun. Denn bereits auf dem ersten und einzigen Album von Flashbax, dem wie die Gruppe albern betitelten Straight Outta Schilfgürtel (über wenigstens einen Stein muss man schließlich auch in den Biografien der besten Bands stolpern, true perfection needs to be imperfect) demonstrierte der damals grade mal volljährige Sänger und Texter Andreas Spechtl in größtenteils Sixties-Pop verschriebenen Songs sein beispielloses Talent, vieles zu sagen, ohne dabei erzählen oder gar belehren zu müssen. Auch sein exaltierter Gesangsstil, mit dem er später dem so oft beschworenen Exzess Ausdruck verleihen sollte, war damals schon ausgereift.
Wie gesagt, so weit war der Weg bis heute nicht. Und doch ist DMD KIU LIDT, das sich „Di-Em-Di-Quiu-Lit“ aussprechende, vierte Album der Gruppe Ja, Panik gewaltig. Allein schon weil es 70 Minuten dauert und weil sein Titelstück trotz Verzichts auf Soli und längere Instrumentalpassagen 14 Minuten dauert. Spechtl legt in diesem trotz epischer Eckdaten kurzweiligen Song einen lyrischen und gesanglichen Höhenflug über eine von Fehlern zerfressene Welt hin, bekennt sich mit einem auf der Aufnahme gelassenen Versprecher aber auch ungeniert zur eigenen Mangelhaftigkeit. Und er wird konkreter als je zuvor, wettert gegen die Politelite: „Ich werde nicht daran denken, eine Träne zu zerdrücken, nicht für Angela und erst recht nicht für Nicolas.“ In „Barbarie“ greift er allem Anschein nach seine Familie an und klagt „I’m tired of leaving“. Letzteres spielt doch bestimmt auf das rastlose Umziehen der Band um des Umziehens willen an, vom Burgenland nach Wien nach Berlin, ohne sich je irgendwo zu Hause zu fühlen. Wird in Berlin endlich der Frieden mit der Außenwelt geschlossen? Machen Ja, Panik hier die umgekehrte Entwicklung von Tocotronic durch? Sind die Österreicher jetzt an den Punkt gekommen, an dem Tocotronic mit ihrem „Weißen Album“ standen, als „eins zu eins vorbei“ war? Beginnt für Ja, Panik jetzt eins zu eins? Moses Schneiders karge Produktion und behutsam instrumentierte Songs, die ohne die für die Band typische Aufgeregtheit und Loud-Quiet-Loud-Strukturen auskommen, so den Fokus ganz auf Spechtls Texte richten, legen eine Bejahung nahe. Doch die Antwort lautet Nein, Halleluja, Nein.
Denn so bleibt wie gehabt die eigentliche Kraft im Unausgesprochenen, wird die durch den allgemeinen Informationsoverkill geschundene Fantasie wieder in Form gebracht. Das effektivste Training erfährt sie in den letzten Momenten des Albums, wenn es nach vielen, vielen Momenten der Verstörung und Erlösung mit einem offenen Ende schließt. Dann fühlt man sich betrogen oder verspürt Gänsehaut an bis dahin unerforschten Körperstellen. Ja, Panik polarisieren, ganz klar. Und das hat große Kunst auch immer getan.