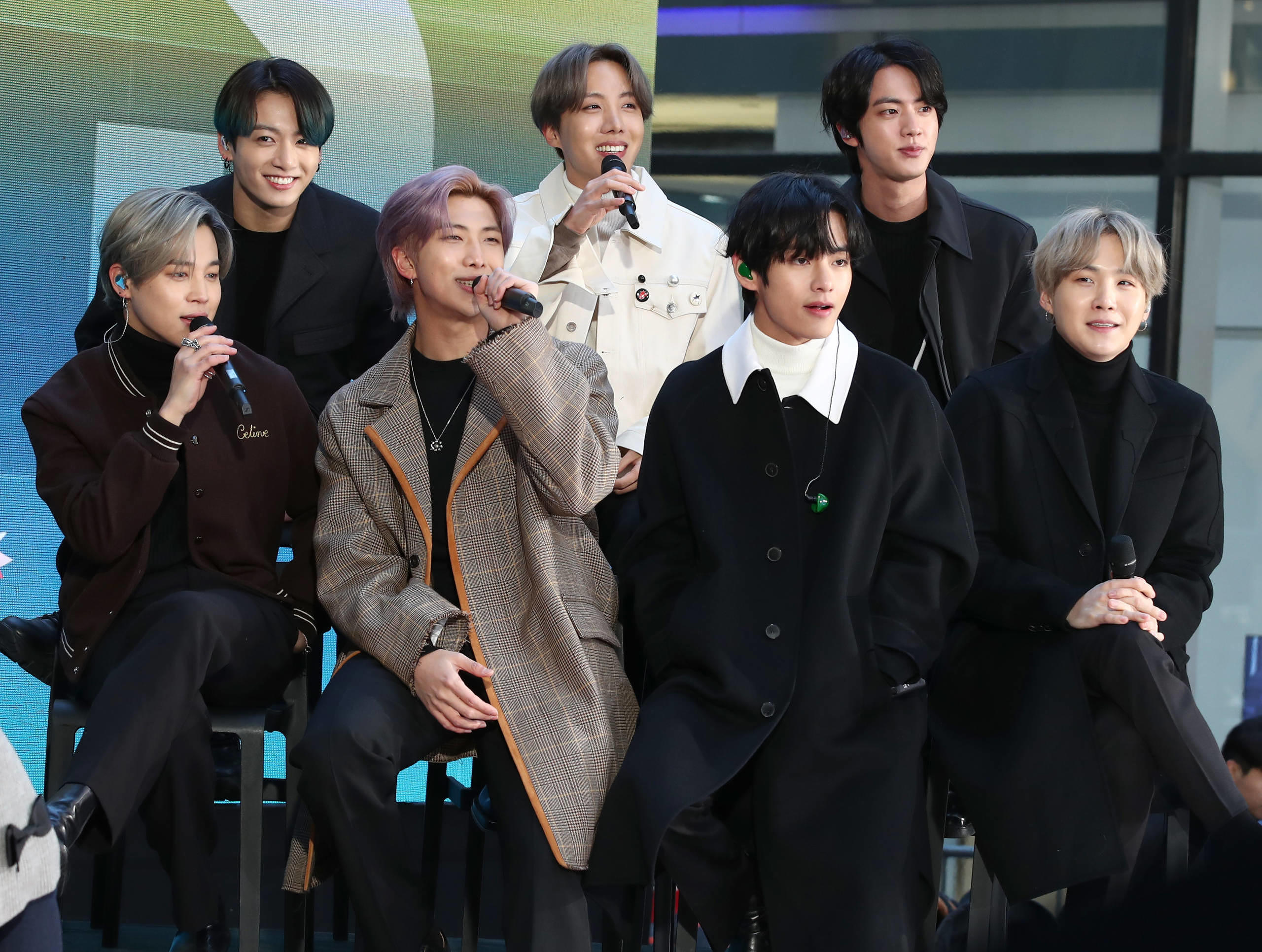Casper, My Bloody Valentine und Björk – Berlin Festival 2013, Tag 2
Casper, My Bloody Valentine und Björk - Berlin Festival 2013, Tag 2: der Nachbericht mit Fotos.
Ein wenig seltsam ist das schon, wenn man am Vorabend das gefühlte Konzert des Jahres besucht hat, und dann bei Tageslicht wieder vor der Hauptbühne steht, wo gerade die White Lies durchaus hörenswerten dunklen Post-Punk, getragen von Harry McVeighs schön vollem Bariton kredenzen.
Aber gut, es muss auch ein „Nach-dem-Blur-Konzert“ geben. Und passt diese Musik gerade nicht sehr gut zu den vielen bleichen Gesichtern vor der Bühne, die sich gestern vermutlich eine etwas längere Nacht gegönnt haben? Tut sie durchaus, aber ein bisschen weniger dunkle Musik zum Tageslicht wäre auch nicht verkehrt. Von daher mal schauen, was Matias Aguayo & The District Union so machen.
Ein deepes wie verstrahltes Live-Set fabrizieren die beiden Herren in schwarzen Hemden mit weißen Höhlenmalerei-Konturen. Deutsch-Chilene Aguayo gibt einen gewohnt unterhaltsamen Elektroniker, der seine Stimme als Instrument nutzt, Spanisch mit Englisch mit Ruggaduggachuckariggidengdeng-Lautmalerei vermengt, und die Geräte klackern, pluckern, bratzen und zirpen lässt. Als Aguayo singend fragt „Who´s afraid of sharks? Who´s afraid of bees?“ gibt es sogar Meldungen.
Dann der ebenso verschmähte wie geliebte Casper, der eine griffig aufspielende Band dabei hat, sich auf einem Banner im Hintergrund der Bühne als „Ins-Wasser-schreitender-Jesus“ inszeniert, und mit seiner wirklich recht erfrischenden Raspelstimme gerade irgendetwas von einem Drittel Heizöl und zwei Drittel Benzin rappt, als auch schon der erste BH aus den vorderen Reihen angeflogen kommt. Und Casper, der Schwerenöter? Fängt das Ding doch tatsächlich noch in der Luft und rumpelstielzt erst mal mit der Trophäe über die Bühne, um sie dann etwas linkisch irgendwo abzulegen.
Der Mann hat eine Mordsenergie und kann performen, keine Frage. Wenn er jedoch alle zwei Minuten „die Hände sehen“, uns zudem „alle springen sehen“ will und sich „sehr freuen würde“, wenn jene, die seine Texte kennen, auch mitsingen, kann er auch ganz schön zum Quälgeist werden. Das Fass mit der Casper´schen Alltagslyrik, die es natürlich auch zuhauf zu hören gibt, machen wir hier besser nicht auf, aber noch mal in Kürze: Ein bisschen weniger Anbiederung und Mitmach-Bettelei würde ihm schon sehr gut stehen. Oder gehört das etwa im HipHop dazu?
Derlei Mätzchen haben My Bloody Valentine jedenfalls nicht nötig. Einmal erklärt Mastermind Kevin Shields sehr nüchtern „We change our set constantly“, da es immer wieder mal leichte Irritationen und Verzögerungen auf der Bühne gibt, später sagt er noch „We gotta go. Goodbye.“
Bevor sie gehen, legen die Shoegaze-Koryphäen jedoch ein Set hin, das am Ende viele vertreibt, und jene die tapfer durchhalten mit, sagen wir mal, einer „musikalischen Katharsis“ belohnt. MBV machen Musik, die – besonders live – im wortwörtlichen Sinne ein körperliches Erlebnis darstellt.
Dafür stehen eben auch die Verstärkertürme, die links und rechts um das Schlagzeug von Colm Ó Cíosóig herum aufgereiht sind, und aus denen eine Musik dringt, die in ihrer Intensität und Lautstärke sehr schmerzvoll für die Gehörgänge sein kann; in der, vergraben unter den gigantischen Gitarrenwänden die Shields mit seinen Tremolos zusammen mit Blinda Butcher produziert, jedoch auch süße Melodien verborgen liegen. Um zu diesen vorzudringen, gilt es, sich dieser Musik komplett zu ergeben, den Schmerz und die Angst vor dem Tinnitus zu ignorieren, die Augen auf die Leinwand hinter den Musikern zu richten, wo die körperliche Erfahrung ihre visuelle Entsprechung in riesigen blauen Pupillen, rasenden Tunnelfahrten (vielleicht in die Pupille hinein?) und so etwas wie den elektronischen Vorgängen zwischen den Synapsen findet.
Am Ende ist alles ein einziges Flirren und Sirren, auf dem Bildschirm scheint eine Kamera durch ein unendliches Gebüsch zu rasen. Weißes Rauschen, das sich immer mehr zu verdichten scheint, als ob hier gleich irgendetwas, die Musiker, man selbst, der Flughafen, abzuheben scheint. Als ob hier gerade der Weltuntergang vertont wird. Wahnsinn, wie Ó Cíosóig dann tatsächlich noch mal in das Rauschen hinein mit dem Schlagzeug nach einem Rhythmus greift.
Betäubt und verwirrt eilt man dann zu Björk auf der Hauptbühne, die man ja auch nicht jeden Tag zu Gesicht bekommt, und wird dort von einem sehr schön vorgetragenen „Hunter“ empfangen.
Einen 11-köpfigen Mädchenchor im Teenageralter, einen Multiinstrumentalisten (Schlagzeug, Percussion, Glockenspiel, Hang) und einen Mann für die Elektronik hat die Isländerin mitgebracht, die selbst in einem zitronengelben Kleid steckt, und deren Kopf mit einer Art transparentem Leucht-Gamsbart umgeben ist.
Wunderhübsch ist das, wenn Björks Kraftorgan mit diesen elf Engelsstimmen kontrastiert, sie die Wörter immer noch auf diese ureigene Weise („Kurrrrriositi“), herauspresst, zu „Jóga“ die „emotional Landscapes“ im Hintergrund vorbeifliegen, und „Hidden Place“ mit dieser himmlischen Chorunterstützung eine ganz neue Qualität gewinnt, die einen fast zu Tränen rühren kann, während sich auf der Leinwand Seesterne paaren.
Gegen Ende wird es dann für Björk-Verhältnisse richtig brachial, wummern Dubstep-Bässe, zu denen sich die Chormädels in ihren Paillettenkleidchen versunken wiegen, ertönen satte Clubbeats, die den Chor sehr heftig und unchoreographiert auf der ganzen Bühne abtanzen lassen, das finale Monster-Bratzstück „Declare Independence“ gerät dann sogar derart brachial, dass einem The Prodigy eher wie ein Kandidat für eine Kindergeburtstags-Compilation erscheinen.
Gut, dass Pantha Du Prince dann noch mit einem herrlich zurückgelehnten und gleichzeitig verhalten energetischen Live-Set zur Stelle ist, das einen mit seinen kristallin-organischen Sounds ganz sanft nach Hause schickt. Schmelzende Eiskristalle zum Abschied. Schön war’s.